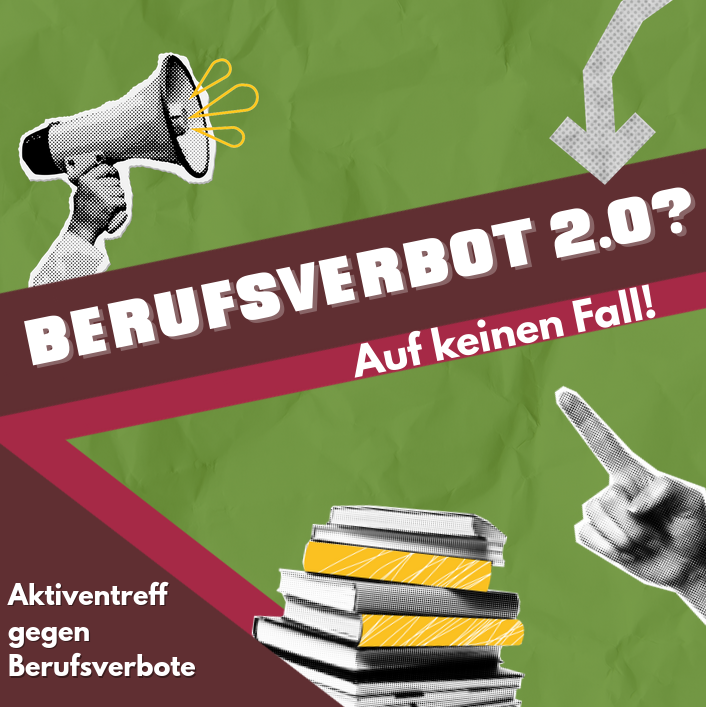taz, Intervies Petra Schellen
Im Auftrag des Hamburger Senats hat Michael Batz ein Theaterstück geschrieben über die Juden, die ins Rigaer Ghetto wie auch ins nahe gelegene KZ Jungfernhof deportiert wurden. Wesentlich gestützt hat er sich dabei auf Prozessakten aus dem Jahr 1977.
Das Stück „Nach Riga“ wird am 27. Januar im Hamburger Rathaus aufgeführt. Anlass ist ein Festakt zum Gedenken an die Befreiung des KZ Auschwitz vor 65 Jahre.
taz: Herr Batz, wie viele Juden aus Norddeutschland wurden vom NS-Regime ins Rigaer Ghetto deportiert?
Michael Batz: Aus Hamburg stammten 753 Personen. Der Zug wurde am 6. 12. 1941 auf dem Güterbahnhof Hamburg-Altona zusammen gestellt und dann nach Bad Oldesloe geführt. Dort kamen weitere 220 Menschen aus Lübeck, Kiel und anderen Städten Schleswig-Holsteins hinzu.
Welche Rolle spielte das Rigaer Ghetto in der deutschen Deportationspolitik?
Riga war dafür ursprünglich gar nicht vorgesehen, man dachte eher an Städte wie Minsk und Lódz. Dann zeigte sich, dass Minsk nicht zur Verfügung stand: Die Wehrmacht hatte angesichts der sich abzeichnenden Niederlage vor Moskau Protest angemeldet, sodass man nach Riga auswich. Dessen Ghetto, das ja schon 1941 gegründet worden war, war allerdings überfüllt. Dort lebten 30.000 lettische Juden. Die SS erschoss sie, um Platz für deutsche Juden zu schaffen. Trotzdem blieben Platzprobleme. Deshalb kamen die Hamburger nicht ins Ghetto, sondern ins KZ Jungfernhof. Das war ein landwirtschaftliches Gut, das die SS beschlagnahmt hatte. Dort gab es zwei große Scheunen ohne Heizung und sanitäre Anlagen. Das alles bei minus 40 Grad Celsius.