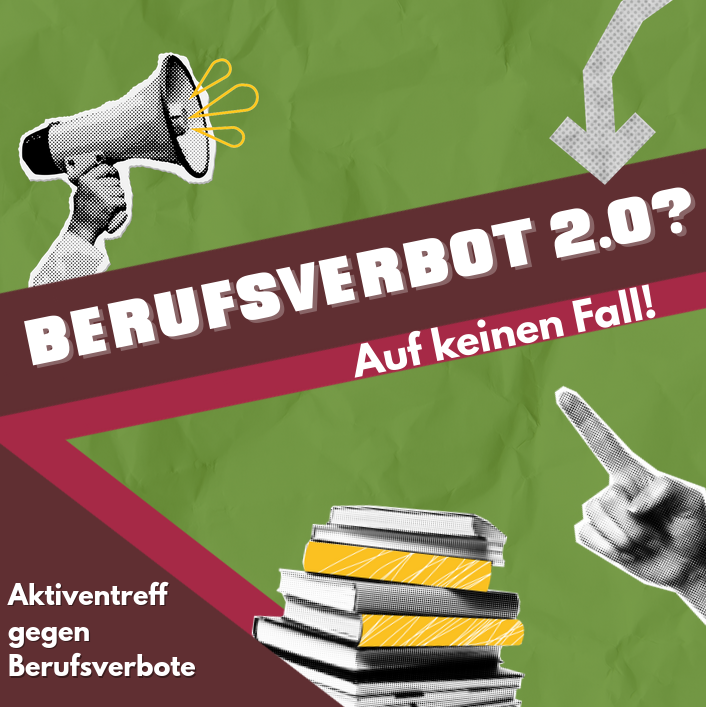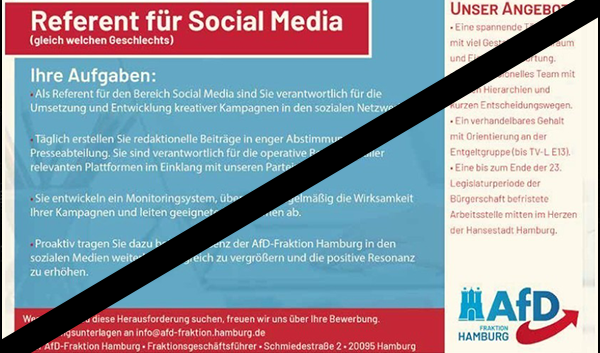Von Lothar Zieske
Hamburgs Nachbarstadt Bremen hat etwas zu bieten, worum wir sie beneiden können: das Theaterprojekt „Aus den Akten auf die Bühne“. Worum es dabei geht, wird auf der zugehörigen Homepage (www.sprechende-akten.de) kurz und knapp erklärt: „Ziel ist es, Akten auf der Bühne zum Sprechen zu bringen.“ Das Projekt, das von der Bremer Historikerin Dr.
Eva Schoeck-Quinteros
und ihren Studierenden einerseits, von der
in Bremen sehr bekannten und beliebten „bremer shakespeare company“ andererseits realisiert wird, läuft bereits seit 2007 mit wechselnden Themen, die von den Studierenden unter der Leitung von Frau Schoeck-Quinteros in einem zweisemestrigen Seminar erarbeitet werden. Im Jahre 2007 erhielt sie dann auch im Rahmen des Jahres der Geisteswissenschaften einen Preis im Wettbewerb „Geist begeistert“.
In diesem Jahr war das Thema „Entnazifizierung von Frauen in Bremen.“ Die Aufführungen liefen unter dem Titel "Was verstehen wir Frauen auch von Politik? Entnazifizierung ganz normaler Frauen in Bremen (1945-1952)".
Das Projekt geht bis etwa zur Jahrtausendwende zurück, als Frau Schoeck-Quinteros zum ersten Mal die Grundidee entwickelte, als sie Ausweisungsakten so genannter „lästiger Ausländer“ entdeckte. Dass die Studierenden seinerzeit nicht dazu bereit waren, diese öffentlich vorzutragen, sollte sich im Nachhinein als ein weiterer Glücksfall erweisen, denn nun war Frau Schoeck-Quinteros gezwungen, wenn sie ihre Idee realisieren wollte, sich einen Kooperationspartner zu suchen. Und einen solchen fand sie in der „bremer shakespeare company“, die alle bisherigen Aufführungen „auf die Bühne“ gebracht hat. Noch heute ist ihr das Erstaunen darüber anzumerken, wie einfach es war, deren Zustimmung zu erlangen.
Um sich einen Eindruck von der Wirkung dieser Präsentationsform zu verschaffen, ist es wichtig, zu wissen, dass die Aufführungen in diesem Jahr wieder im Schwurgerichtssaal des Landgerichts Bremen stattfinden, eines 110 Jahre alten Gebäudes, wie Peter Lüchinger von der „bremer shakespeare company“ dem wartenden Publikum dort vor Beginn der Vorstellung mitteilt. Er weist auch darauf hin, dass das Eichenholz des Inventars und der Vertäfelung astrein im Wortsinn sei – eine beeindruckende Kulisse, die es mit jeder Theaterbühne aufnehmen kann. Die Aufgabe, die Akten „zum Sprechen“ zu bringen, wird von den drei Schauspielerinnen und den zwei Schauspielern mit Bravour bewältigt. Sie füllen mit ihren Stimmen – wie es scheint: mühelos – den großen, hohen Raum und ziehen das Publikum in die Atmosphäre hinein, wie sie zu der Zeit vor Spruchkammern geherrscht haben mag. Vor diesen Laiengerichten wurden Entnazifizierungsverfahren meist öffentlich verhandelt. In den für die Lesung ausgewählten Fällen ging es u.a. um Denunziation, Bespitzelung, Vernehmung von Gefangenen, Schreibarbeiten für die Gestapo, – um Tätigkeiten also, die entweder auf den ersten Blick profaschistisch oder aber nicht eindeutig zu bewerten waren, zumal die beschuldigten Frauen natürlich versuchten, sie als möglichst harmlos darzustellen. Wie Frau Schoeck-Quinteros im Gespräch mit der „taz“ (21.9.11) sagt, hatten Frauen, anders als Männer, manchmal gute Chancen, einen Persilschein zu bekommen – "wenn sie einem bestimmten Bild der Weiblichkeit gefolgt sind". (Vgl. dazu den Untertitel: "Was verstehen wir Frauen auch von Politik?“)
Der Erfolg des Projektes zeigt sich zum einen darin, dass die 9 Aufführungen ausverkauft waren und dass wegen des großen Erfolg sogar noch eine weitere stattfinden wird. Mindestens genau so wichtig ist aber, dass die Bremer Studierenden von Frau Schoeck-Quinteros etwas geboten bekommen, was in den 70er Jahren als „forschendes Lernen“ bezeichnet wurde, selten aber wohl so sehr sein Ziel erricht haben dürfte wie hier.
Frau Schoeck-Quinteros hat gerade ein neues Projekt begonnen, dass auch wieder ein heißes Eisen behandelt: Deserteure – in diesem Fall allerdings nicht, wie im Fall der Hamburger Gruppe, die ein Deserteursdenkmal am Dammtor errichten lassen möchte – , Deserteure im Zweiten, sondern im Ersten Weltkrieg:
zur Tradition des Projekts gehört es, dass die Forschungsergebnisse der Studierenden, eingeleitet von der Dozentin, in einem Sammelband veröffentlicht werden; so auch in diesem Fall: Eva Schoeck-Quinteros (Hrsg.): „Was verstehen wir Frauen auch von Politik?“ Entnazifizierung ganz normaler Frauen in Bremen (1945-1952), Bremen 2011, 420 S., Preis: 12 EUR. ISBN 978-3-88722-725-8. Der Band kann über Buchhandlungen oder über die website (s. o.) bestellt werden.
Termine: Dienstag, 8.11., 19.30 Uhr/ Dienstag, 15.11., 19.30 Uhr/ Dienstag, 22.11., 19.30 Uhr. – Ort: Landgericht Bremen, Domsheide 16.
Lothar Zieske