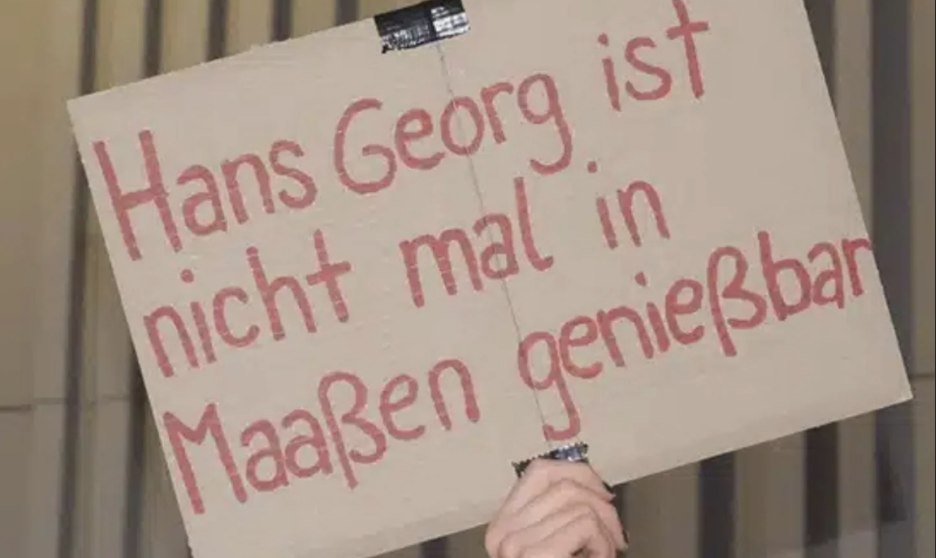taz, Andreas Speit
Nach dem Auffliegen des Nationalsozialistischen Untergrunds Ende vorigen Jahres schienen deutsche Innenpolitiker für einen Moment zur Selbstkritik fähig. Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich gestand ein, dass „einige Behörden“ völlig versagt hätten. Heinz Fromm, der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, sprach von einer „Niederlage der Sicherheitsbehörden“. Und Generalbundesanwalt Harald Range nannte die NSU-Morde sogar „unseren 11. September“.
Ehrliche Worte, denen aber bis heute keine praktischen Konsequenzen gefolgt sind. Statt die schonungslose Aufarbeitung des Versagens von Behörden und der Verstrickung von Sicherheitsorganen in die Serie rechtsextremer Morde zu beginnen, lösten Politiker lieber eine neue Auseinandersetzung über ein NPD-Verbot aus. Kaum war die Nazi-Bande enttarnt, befeuerte der Generalbundesanwalt die Debatte mit der Behauptung, es sei mit „weiteren Belegen“ für die Nähe zwischen NSU und NPD zu rechnen. Dass derselbe Generalbundesanwalt später betonte, es sei nun doch kein direkter Zusammenhang zwischen Terrorgruppe und Partei zu erkennen, spielte schon keine Rolle mehr. Mit der Verbotsdebatte hatten Bundesregierung und Sicherheitsorgane da bereits die Diskurshoheit zurückerobert.
Uncategorized