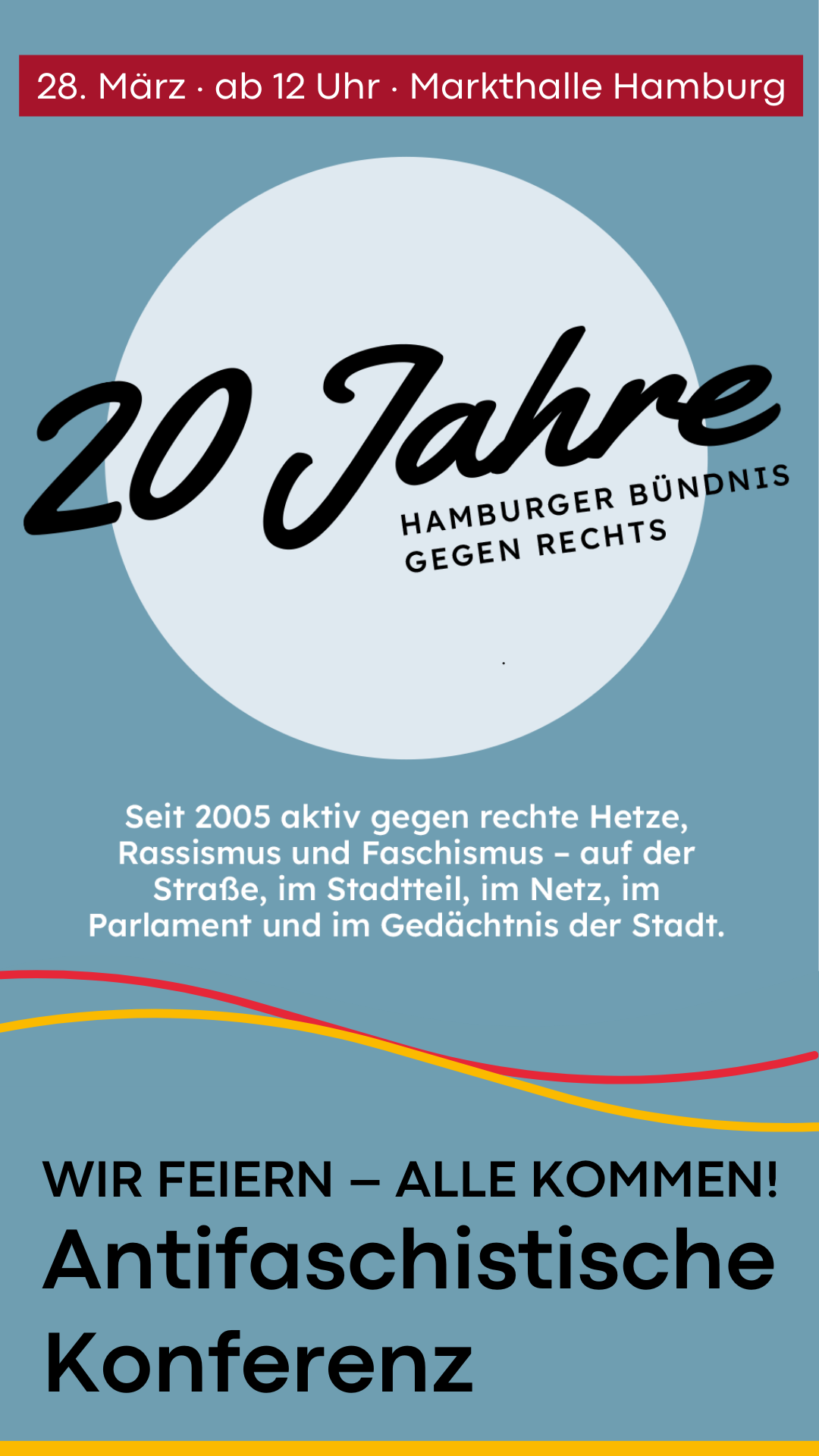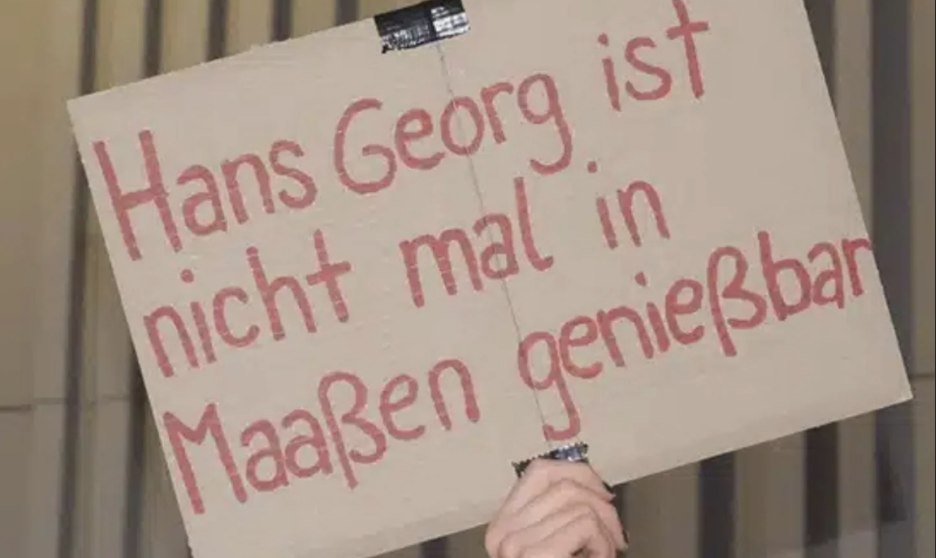Lokalberichte Hamburg 14/ 09, von Lothar Zieske
Am 6. Juli wurde im Westflügel des Greve-Baus der Universität eine Ausstellung mit dem Titel „Was damals Recht war …“ eröffnet. Sie wird im Foyer desselben Gebäudes noch bis zum 8. August gezeigt. Schon der Titel verletzt offenbar empfindliche Gemüter (man könnte ergänzen: „noch heute“), wie sich dem Artikel in DIE WELT – ONLINE vom 7.Juli entnehmen lässt. Dieser macht mit dem bekannten Filbinger-Zitat auf, fasst es dann aber im Text nur mit spitzen Fingern an: „Als Motto der Ausstellung wurde der schwierige Zitatbeginn ‚Was damals Recht war …’, der eigentlich kontrovers endet mit ‚ … kann heute kein Unrecht sein’ gewählt. Es wird dem ehemaligen NSDAP-Mitglied und späteren Ministerpräsidenten Hans Filbinger zugeschrieben.“ Nicht nur, dass mit dem Ausdruck „zugeschrieben“ Distanz zwischen Filbinger und das genannte Zitat gelegt wird, sondern darüber hinaus wird Filbinger zu einem von Millionen NSDAP-Mitglied verharmlost; von dem „furchtbaren Juristen“ (Rolf Hochhuth), der als Marinerichter gegen einfache Soldaten mit Todesurteilen wütete, „bis alles in Scherben“ fiel, ist nun nicht mehr die Rede.
Auch die Eröffnungsveranstaltung war von solchen Peinlichkeiten nicht frei; sie betrafen allerdings nur den Justizsenator. Die Peinlichkeit, dass die ehemalige Präsidentin, Monika Auweter-Kurtz, zu Beginn die Veranstaltung im Namen der Universität eröffnet hätte, blieb dem Publikum erspart. Statt dessen sprach der für sie eingesprungene Vizepräsident, Professor Holger Fischer, wenige, aber doch gut gewählte Worte.
Der Rede des Justizsenators Till Steffen kam eigentlich eine große Bedeutung zu, da die Ausstellung auf Initiative des ehemaligen Vorsitzenden des Hamburger Richtervereins nach Hamburg gekommen war.[1] (Vorher war sie schon in 11 Städten gezeigt worden.) Juristischer Sachverstand war das Mindeste, was von ihm zu erwarten gewesen worden. Leider unterlief ihm die Peinlichkeit, dass er die Begriffe „Deserteur“ und „Kriegsverräter“ verwechselte. Dass dies in der journalistischen Berichterstattung immer wieder geschieht (z. B. in mehreren Artikel der jungen Welt), macht die Sache nicht besser. Aufklärung hätte gerade in dem Punkt „Kriegsverrat“ bitter Not getan.
Der klassische Begriff von „Kriegsverrat“, der heute noch in vielen Köpfen spukt, lässt sich mit dem Beispiel des Athener Feldherrn Alkibiades illustrieren, der im Peloponnesischen Krieg (432-404) nach seiner fehlgeschlagenen abenteuerlichen Sizilienexpedition zu den Spartanern überlief und ihnen wertvolle Hinweise gab, durch die diese zeitweise bedeutende militärische Erfolge erzielen konnten. Auch heute noch könnte man die Wut Athener Bürger über Alkibiades verstehen.
Zwischen diesem Beispiel und der NS-Militärjustiz ist kein Vergleich möglich: Die gesetzlichen Bestimmungen gegen „Kriegsverrat“ waren in der NS-Militärjustiz zu einem reinen Repressionsinstrument gegen einfache Soldaten geworden. Hilfe für Juden oder Nichtanzeige von angeblichem „Kriegsverrat“ wurden als „Kriegsverrat“ verfolgt. Das alles ist spätestens seit den Forschungen des Historikers Wolfram Wette („Das letzte Tabu“) erwiesen.[2] Die „nicht auszuschließende Lebensgefährdung“, die angeblich von den „Kriegsverrätern“ der Wehrmacht für ihre Kameraden ausgegangen sei, von der bis zum heutigen Tag immer noch einige CDU-Bundestagsabgeordnete phantasieren, hat es in keinem Fall gegeben. Die „Kriegsverräter“ sind, im Gegensatz zu den Deserteuren, immer noch nicht rehabilitiert. (Dies soll noch nach der Sommerpause geschehen.)
Ludwig Baumann hat sich nicht darauf beschränkt, für die Rehabilitierung der Opfergruppe, der er selbst angehört – die der Deserteure – zu kämpfen, sondern er setzte sich, nachdem er diese (2002) erreicht hatte, weiterhin für die „Kriegsverräter“ ein.
In seiner Ansprache berichtete er über die Geschichte seiner Desertion, für die er zunächst mit dem Tode bestraft worden war. Er wurde über die Umwandlung des Todesurteils in Unkenntnis gelassen, musste an jedem Morgen seine Hinrichtung befürchten, wurde dann in das Wehrmachtsgefängnis Torgau gebracht, den Sitz des damaligen Kriegsgerichts. Nur durch das zweifelhafte „Glück“ einer schweren Erkrankung überlebte er den Zweiten Weltkrieg. (Von den „Kriegsverrätern“ überlebte keiner; sie wurden ausnahmslos exekutiert.)
Die Nachkriegszeit bis in die Zeit der Friedenbewegung der 80er Jahre war für Ludwig Baumann eine Zeit der Demütigungen gewesen, die sein Leben fast zerstört hätte. Erst in den 80er Jahren wurden die Deserteure der Wehrmacht als Vorbilder entdeckt.
Es sollte aber noch bis zum Jahre 1990 dauern, bis er, zusammen mit 35 Männern und einer Frau die Organisation „Opfer der NS-Militärjustiz“ – spät, aber nicht zu spät – gründen konnte.
2002, als die Deserteure schließlich rehabilitiert worden waren, war das für Ludwig Baumann ein großer Erfolg, aber es gab auch einen großen Wermutstropfen dabei: Herta Däubler-Gmelin, die ehemalige SPD-Justizministerin, die das Anliegen der Deserteure unterstützt hatte, war inzwischen Mitglied eines Kabinetts, das Krieg gegen Jugoslawien geführt hatte. Die hiermit verbundene Enttäuschung dürfte Ludwig Baumann bis heute nicht verwunden haben; jedenfalls griff er die Politik der Kriegsparteien, die das Kabinett Schröder bildete, mit deutlichen Worten an. Seine Kritik dürfte dem grünen Justizsenator in den Ohren geklungen haben.
Abgesehen davon, dass seine Organisation für alle „Opfer der NS-Militärjustiz“ (sofern sie nicht Täter waren) kämpft, hatte Ludwig Baumann eine zusätzliche persönliche Motivation, sich weiter für die Rehabilitierung der „Kriegsverräter“ einzusetzen, dadurch, dass er im Wehrmachtsgefängnis Torgau den „Kriegsverräter“ Johann Lukaschitz kennen gelernt hatte. Auf die SPD konnte Ludwig Baumann, als er sich weiter für die „Kriegsverräter“ einsetzte, nicht mehr zählen. Die SPD blieb lange uneinsichtig. Die PDS/ DIE LINKE verfolgte hingegen zielstrebig die Rehabilitierung der „Kriegsverräter“ und stellte entsprechende Anträge im Bundestag. Inzwischen ist die Mehrheit für ein Rehabilitierungsgesetz wohl sicher. Letzter unwürdiger Schlenker: Man möchte nicht einem Gesetzesantrag der LINKEN zustimmen.
Ludwig Baumanns Position ist klar und eindeutig, und auch hier dürfte der Justizsenator zusammengezuckt sein: „Kriegsverrat“ ist auch heute noch eine Friedenstat für ihn.
Johann Lukaschitzs Hinrichtung konnte Ludwig Baumann verhindern. Aber Schmach und Vergessen konnte er wenigstens, wenn auch erst Jahrzehnte nach seiner Ermordung, von ihm abwenden. Die Ausstellung wird vom 7. Juli bis zum 8. August im Westflügel der Universität Hamburg. Edmund-Siemers-Allee 1, 20146 Hamburg gezeigt.Öffnungszeiten: Mo-Fr 7 – 21 Uhr, Sa 7 – 15 Uhr.Der Eintritt ist frei.
[1] Neben anderen Institutionen war außer der „Bundesvereinigung Opfer der NS-Militärjustiz“ die „Stiftung
Denkmal
für die ermordeten Juden Europas“ maßgeblich am Zustandekommen der Ausstellung beteiligt. Für sie sprach Uwe Neumärker.
[2] Zu diesem
Thema fand im September 2007 eine Veranstaltung von Wolfram Wette und Ludwig Baumann statt, über die ich für die „Lokalberichte“ 21/07 (11.10.) einen Artikel geschrieben habe. – In seiner Rede am 6.Juli 2009 wies Ludwig Baumann darauf hin, dass alle erforschten Fälle von „Kriegsverrat“ in der Wehrmacht“ „moralisch-ethisch fundiert“ gewesen seien.