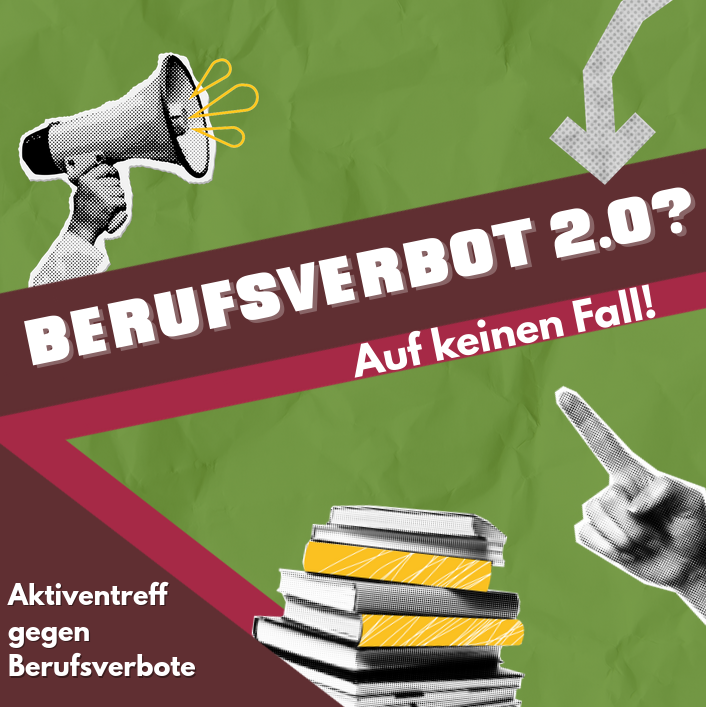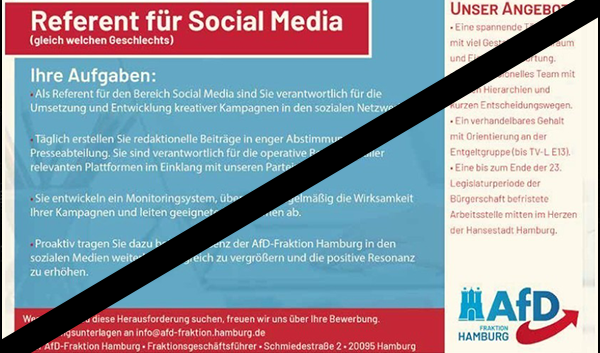Dokumentation
"Mobile Beratungsteams und Opferberatungsprojekte beraten und begleiten Opfer rechter Gewalt, Kommunen und Zivilgesellschaft. Auch wenn wir seit Jahren vor der Gewalt von Neonazis und rassistischen Gelegenheitstätern
warnen, sind wir geschockt von dem Ausmaß an Ignoranz und Verharmlosung staatlicher Stellen angesichts der rassistischen Mordserie. Wir verlangen jetzt eine Zäsur im Umgang mit der extremen Rechten.
1. Eingreifen und einmischen statt wegsehen
Jeden Tag ereignen sich in Deutschland mindestens zwei bis drei rechte und rassistische Gewalttaten. Die TäterInnen sprechen vor allem denjenigen das Recht auf körperliche Unversehrtheit und Leben ab, die als Minderheiten ohnehin schon gesellschaftlich diskriminiert werden. Das zu ändern und eine inklusive Gesellschaft zu schaffen, können wir
nicht an den Staat delegieren: Jede und jeder kann bei rassistischen Sprüchen am Arbeitsplatz, antisemitischer Hetze auf dem Sportplatz oder "Schwulenwitzen" Kontra geben und eingreifen, wenn andere bedroht und geschlagen werden. Und jede und jeder kann jetzt praktische Solidarität zeigen: z.B. Spenden für Einrichtungen sammeln, die Zielscheibe von neonazistischen Brandanschlägen geworden sind oder den Menschen in diesen Einrichtungen persönlich in Gesprächen oder praktisch beistehen.
2. Mehr Demokratie statt mehr Verfassungsschutz
Polizei, Justiz und Geheimdienste spiegeln gesellschaftliche Verhältnisse wider. In einem Land, in dem regelmäßig ein Drittel erklären, Deutschland sei "im gefährlichen Maße überfremdet", ist es keine Ausnahme, dass Sonderkommissionen "Aladin" oder "Bosporus" genannt und Opfer rassistischer Gewalt unter Generalverdacht gestellt werden. Schon die Bezeichnung "Döner-Morde" ist rassistisch und entwürdigend. Nationale Terrorabwehrzentren und neue Gesamtdateien von Polizei und Geheimdiensten werden daran nichts ändern. Ein erster Schritt wäre eine klare Abkehr von den Feindbildern der "Linksextremisten", "Muslime" und "Fremden". Der Rassismus der Mitte muss als Problem erkannt werden.
3. Zivilgesellschaftliche Expertisen anerkennen und nutzen
Der derzeitige Schock der politisch Verantwortlichen über den Terror des
"Nationalsozialistischen Untergrunds" lässt sich nur damit erklären,
dass sie die öffentlich zugänglichen Informationen und Analysen der
zivilgesellschaftlich Aktiven gegen Rechts und Rassismus –
Antifagruppen, Bündnisse und Beratungsprojekte – offenbar komplett
ignoriert und stattdessen nur auf die Geheimdienste gehört haben. Wer
die falschen BeraterInnen in der Auseinandersetzung mit der extremen
Rechten setzt, kann nur verlieren – und spielt mit dem Feuer. Künftig
muss der Erfahrungsschatz der zivilgesellschaftlichen ExpertInnen
angemessenes Gehör finden.
4. Staatliche Alimentierung der Neonazis beenden, V-Leute abschaffen
V-Leute sind vom Staat bezahlte Neonazis, die Steuergelder dazu
verwenden, um Neonazistrukturen auszubauen und zu stabilisieren sowie
staatliche Stellen allenfalls mit fragwürdigen Informationen zu
versorgen. In der Geschichte der deutschen Neonazibewegung waren immer
wieder V-Männer und -Frauen in tödliche Attentate (Wehrsportgruppe
Hoffmann) und Brandanschläge (Solingen) involviert, haben die Produktion
und den Vertrieb neonazistischer Hassmusik organisiert (Brandenburg und
Sachsen), NPD-Landesverbände am Laufen gehalten (Nordrhein-Westfalen),
mit Steuergeldern militante Neonazistrukturen wie den Thüringer
Heimatschutz und Blood&Honour aufgebaut und ein NPD-Verbot im Jahr 2003
verhindert.
5. Lückenlose Aufklärung und Konsequenzen auf allen Ebenen
Alle Daten und Informationen, die notwendig gewesen wären, um mit
polizeilichen und rechtsstaatlichen Mitteln schon 1998 – vor Beginn der
rassistischen Mordserie – gegen den Kern des "Nationalsozialistischen
Untergrunds" (NSU) vorzugehen, lagen den Strafverfolgungsbehörden und
Geheimdiensten gleichermaßen vor. Doch diese Informationen wurden mit
einer Mischung aus Verharmlosung, Entpolitisierung und Inkompetenz von
Polizei, Justiz und Geheimdiensten ignoriert, wie sie bei rechter Gewalt
immer wieder zu beobachten war und ist. Wer jetzt Aufklärung verspricht,
muss überall dort, wo Versagen offenkundig geworden ist, auch personelle
Konsequenzen ziehen, egal ob in Innenministerien, Geheimdiensten oder
Strafverfolgungsbehörden.
Die Angehörigen der Ermordeten, die Verletzten der Nagelbombenanschläge
und die Communities, die durch die Attentate der NSU unmittelbar
betroffen sind, aber auch die Gesellschaft als Ganzes haben ein Recht
darauf, dass eine lücken- und schonungslose Aufklärung in aller
Öffentlichkeit stattfindet.
6. Nebelkerze NPD-Verbot ad acta legen
Die zum x-ten Mal geführte Debatte über ein NPD-Verbot verstellt den
Blick auf das schockierende Ausmaß staatlicher Verharmlosung der
extremen Rechten und gesamtgesellschaftlichen Rassismus. Effektiver als
jede reflexartige Debatte wäre ein geschlossenes Vorgehen aller
demokratischen Parteien dort, wo sie mit der NPD konfrontiert sind. Die
NPD und die extreme Rechte sind überall dort stark, wo demokratische
Parteien und die Zivilgesellschaft ihnen nicht ge- und entschlossen
entgegen treten. Dass sich, wie in Sachsen, die CDU-geführte Regierung
nach diskreditierenden parlamentarischen Anfragen der NPD nicht zur
wertschätzenden Unterstützung von Beratungsprojekten gegen Rechts
durchringen kann, ist kein Einzelfall.
7. Engagement gegen Rechts braucht Anerkennung und Unterstützung statt
Diffamierung und Kriminalisierung
Bei den Protesten gegen den Neonaziaufmarsch in Dresden im Februar 2011
wurden Hunderttausende Telefonate abgehört, bei Ermittlungen gegen
NeonazigegnerInnen wegen Aufrufen zu Blockaden wird nicht einmal mehr
vor Kirchgemeinden Halt gemacht. Anstatt Antifa-Gruppen,
GewerkschafterInnen, Bündnisse gegen Rechts, KommunalpolitikerInnen und
andere zu diffamieren und zu kriminalisieren, müssen sie Anerkennung,
Unterstützung und Ermutigung durch politisch Verantwortliche aller
Parteien erfahren. Wer Misstrauen gegen engagierte BürgerInnen sät, wird
mehr rechte und rassistische Gewalt ernten. Und wer militante
Kameradschaften schwächen will, muss alternative, nicht-rechte
Jugendkulturen fördern.
8. "Extremismusklausel" abschaffen
Die Bundesregierung zwingt die Projekte gegen Rechtsextremismus,
Rassismus und Antisemitismus zur Unterschrift unter eine so genannte
"Demokratieerklärung", mit der sich die Projekte verpflichten sollen,
ihre PartnerInnen auf Verfassungstreue zu prüfen und sie zu bespitzeln.
Als Grundlage für die Einschätzung der Verfassungstreue von
KooperationspartnerInnen sollen ausgerechnet die Berichte des
Verfassungsschutzes dienen. Die rassistischen Diskurse aus der Mitte der
Gesellschaft bleiben dabei außen vor. Die zivilgesellschaftliche Arbeit
wird seit Jahren beeinträchtigt durch die historisch falsche,
wissenschaftlich unsinnige und politisch gefährliche
"Extremismustheorie", die Rechtsextremismus und Linksextremismus und
damit auch Faschismus und Antifaschismus gleichsetzt.
9. Langfristige Planungssicherheit für Projekte gegen Rechtsextremismus
und Ausweitung der bewährten Beratungsprojekte in den alten Bundesländern
Die Arbeit gegen die extreme Rechte braucht einen langen Atem, ist eine
gesamtgesellschaftliche Daueraufgabe und kein Strohfeuer und muss
entsprechend dauerhaft gefördert werden. Außerdem sind rechte Gewalt und
extrem rechte Aktivitäten keine Ostprobleme. Die Mehrheit der NSU-Morde
ereignete sich in den alten Bundesländern – in Regionen, in denen seit
langem militante Neonazistrukturen aktiv sind. Die Beratungsprojekte in
den neuen Bundesländern und Berlin arbeiten seit nunmehr über 10 Jahren
erfolgreich und unabhängig, dennoch wurden ihnen wiederholt die Mittel
gekürzt.
Die Mobilen Beratungsteams sind AnsprechpartnerInnen für
KommunalpolitikerInnen und Zivilgesellschaft; die Beratungsprojekte für
Opfer rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt unterstützen und
begleiten Betroffene,
ZeugInnen
und
Angehörige bei der Bewältigung der
Tatfolgen. Diese Projekte sind derzeit mit zum Teil massiven
Mittelkürzungen konfrontiert. In den alten Bundesländern sind sie
komplett unterfinanziert oder existieren aus Mangel an Fördergeldern
erst gar nicht. Wenn Bundesfamilienministerin Kristina Schröder (CDU)
jetzt erklärt, in ihrem Haushalt seien die Millionen aus dem Programm
gegen "Linksextremismus" noch nicht abgerufen worden, dann müssen diese
Gelder umgehend zum Aus- und Aufbau der bewährten Strukturprojekte gegen
Rechts zur Verfügung gestellt werden. Das wäre ein erster Schritt, dem
weitere – wie ein Ende der Kürzungen bei den Antidiskriminierungsbüros –
folgen müssen.
10. Rassismus endlich beim Namen nennen
Es ist unbegreiflich, dass im Zusammenhang mit den NSU-Morden von
"Fremdenfeindlichkeit" die Rede ist. Die Ermordeten waren mitnichten
"Fremde", "Türken" oder "Griechen", sondern repräsentieren die Mitte
unserer Gesellschaft. Es ist Zeit, endlich von Rassismus und dem Wahn
der "White Supremacy" ("Überlegenheit der Weißen") zu sprechen, denn
dies war das Motiv der Neonazis. Wir wollen eine Gesellschaft, in der
alle Menschen gleiche Rechte haben und gleich geschützt werden –
unabhängig von ihrer Herkunft, ihrem Status und allen anderen "Merkmalen"."
Ersunterzeichner:
– ezra – Mobile Beratung für Opferechter, rassistischer und
antisemitischer Gewalt in Thüringen
– Info- und Bildungsstelle gegen Rechtsextremismus im NS-DOK der Stadt
Köln, Träger der Mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus im RB Köln
– Kulturbüro Sachsen e.V.
– LOBBI – Landesweite Opferberatung, Beistand und Information für
Betroffene rechter Gewalt in Mecklenburg-Vorpommern
– MBR – – mobim – Mobile Beratung im Regierungsbezirk Münster
– Miteinander e.V. – Netzwerk für Demokratie und ein weltoffenes
Sachsen-Anhalt
– Mobile Beratung in Berlin
– Mobile Beratung für Opfer rechter Gewalt in Sachsen-Anhalt
– MBR – Mobile Beratung gegen Rechtsexremismus Berlin
– Opferperspektive Brandenburg e.V.
– Opferberatung der RAA Sachsen e.V.
– Reach Out – Opferberatung und Bildung gegen Rechtsextremismus,
Rassismus und Antisemitismus, Berlin
– Regionale Arbeitsstelle für Bildung, Integration und Demokratie (RAA)
Mecklenburg-Vorpommern e. V.