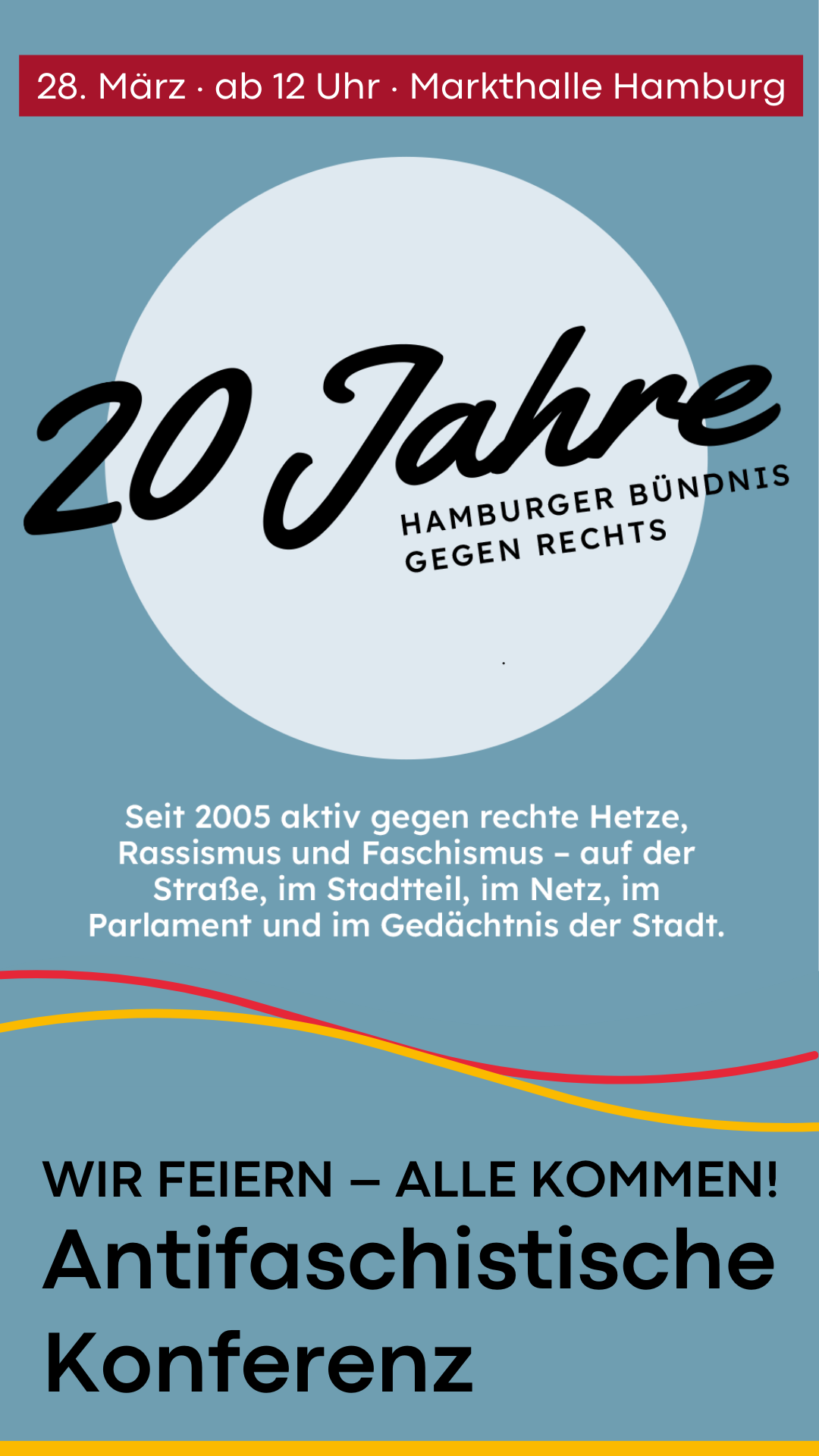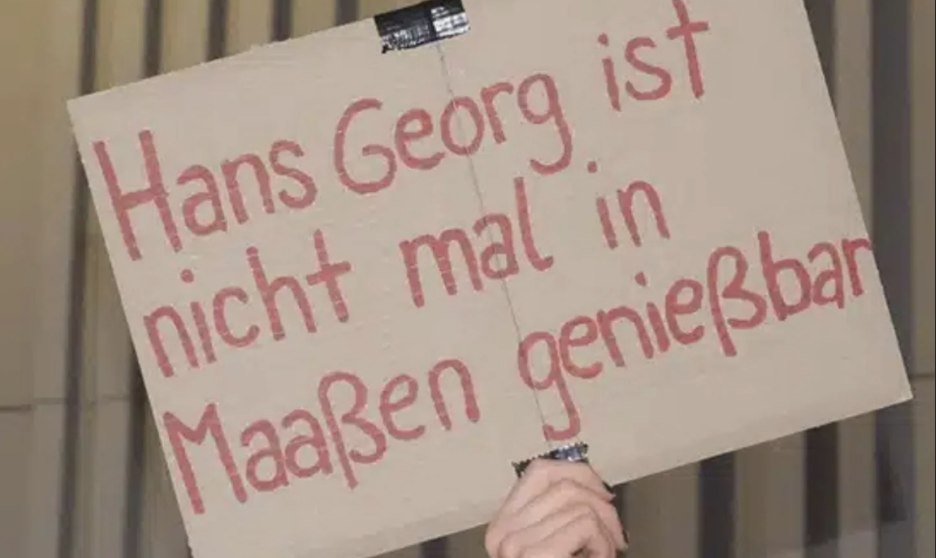Tagung zum Thema „Hamburger Kriegsgerichte und die Deserteure des Zweiten Weltkrieges“
von Lothar Zieske
In der letzten Ausgabe der Lokalberichte Hamburg habe ich über die Podiumsdiskussion berichtet, die zu Beginn der Veranstaltungswoche „Aufklärung und Protest – Erinnern an Opfer und Täter des Krieges“ stattfand. Den Schwerpunkt dieser Woche bildete ein Seminar mit dem oben genannten Titel.
Der Auftakt fand im Philosophenturm der Universität statt (17.11.). Dort hielt der Historiker Magnus Koch den Eröffnungsvortrag unter dem – wie ich finde – etwas preziösen Titel „Der höhere Sinn des Davonlaufens“. Magnus Koch ist als Kenner der Thematik ausgewiesen durch seine Dissertation (Fahnenfluchten, Diss. Erfurt 2006, erschienen: 2008) sowie durch seine Mitarbeit am Begleitband zur Wanderausstellung "Was damals Recht war … – Soldaten und Zivilisten vor Gerichten der Wehrmacht" (2008), die auch in Hamburg gezeigt und über deren Eröffnung auch in den LB 14/ 2009 (17.7.) berichtet wurde.
Die Besonderheit der Quellen, die er benutzen konnte, bestand darin, dass es sich um Aussagen von Deserteuren der Wehrmacht handelte, die in die Schweiz hatten entkommen können und vor Schweizer Behörden – ohne Gefahr für Leib und Leben – aussagten.
Koch brachte Fallbeispiele sowie viele Einzelheiten und beantwortete in der anschließenden Diskussion viele Fragen, doch, ohne dem Fachmann zu nahe treten zu wollen, fand ich, dass das Ergebnis keine großen Überraschungen enthielt (was, ins Positive gewendet, aber auch als ein Zeichen dafür gedeutet werden kann, wie viele Forschungen zum Thema schon vorliegen, ungeachtet immer noch bestehender Lücken):
– Die Frage nach den Ursachen für die im Vergleich zu den Zahlen der Alliierten furchtbare Urteilsbilanz der NS-Militärjustiz wurde mit dem von dieser verfolgten Ziel der Abschreckung erklärt, – die Motive der Deserteure wurden als schwer zu verallgemeinern bezeichnet. Selten habe ein einziges Motiv zu Grunde gelegen; meist habe es sich um ein Motivbündel gehandelt. Pazifismus, politische oder religiöse Motive seien eher in der Minderzahl gewesen.Auch Ludwig Baumann, der fast 90jährige und inzwischen einzige Deserteur der Wehrmacht, der noch öffentlich auftritt, spricht nicht von Heldentum, wenn es um seine und um die Desertion seiner Kameraden geht.
Am nächsten Morgen, als in der KZ-Gedenkstätte Neuengamme die Tagung fortgesetzt werden sollte, saß Ludwig Baumann dort auf den Stufen vor dem Studienzentrum, einem Klinkerbau aus den Jahren 1943/44, und sagte: „Ich kann des Wort Deserteur nicht mehr hören.“ Eine Frau, die dies mitbekommen hatte, missverstand seine Worte und fragte ihn: „Was möchten Sie dann stattdessen hören?“ Baumann antwortete: „Ach, meinetwegen ‚Feigling’ oder sonst etwas!“ Es zeigte sich, dass er hatte sagen wollen, dass seine Desertion ein so scharfer Einschnitt in sein Leben gewesen war, dass er bis zum heutigen Tag darunter leide.
Am späten Nachmittag wurde in dem Vortrag des Schriftführers der „Bundesvereinigung Opfer der NS-Militärjustiz“, Günther Knebel, auch Ludwig Baumanns Geschichte erzählt: „Die späte Anerkennung der Deserteure als Opfer des Nationalsozialismus in der Forschung, der Öffentlichkeit und in der Politik“. Die wesentlichen Stufen dieser Entwicklung hatte Baumann bereits in seinem – wie er selbst betonte – „sehr persönlichen“ Grußwort am Morgen aus eigenem Erleben beschrieben.
Vieles, was darauf folgte, war wissenswerte Information (z. B. der Vortrag Detlef Garbes, des Leiters der KZ-Gedenkstelle, der unmittelbar auf Baumanns Grußwort folgte: „Spuren der Wehrmachtjustiz in Hamburg“), Anderes (wie das Referat Lars Skowronskis: „Die Hamburger Opfer der Wehrmachtjustiz – Namensermittlungen, Fallbeispiele“) war methodisch wichtig unter dem Aspekt, dass der Opfer der NS-Militärjustiz namentlich gedacht werden soll. Skowronski machte auf die Lagerorte wichtiger Quellen aufmerksam: Neben dem Militärarchiv Freiburg sind dies im vorliegenden Fall die „Deutsche Dienststelle WASt“, die, unmittelbar vor der Entfesselung des Zweiten Weltkriegs als Dienststelle des Oberkommandos der Wehrmacht unter der Bezeichnung „Wehrmachtauskunftstelle für Kriegerverluste und Kriegsgefangene“ gegründet, als „lebende“ Kartei heute noch die Funktion der Benachrichtigung der nächsten Angehörigen von Gefallenen der ehemaligen deutschen Wehrmacht hat. In der NS-Zeit bestand ihre Aufgabe darin, den Überblick über „Kriegerverluste“ zu erhalten, worunter der Ausfall von Soldaten sowohl durch Krankheit, Tod aus natürlichen Ursachen, Selbstmord oder Hinrichtung gemeint sein konnte. Die Benutzung der WASt-Kartei ermöglicht es, an Informationen zu gelangen, um beispielsweise die Voraussetzungen für das Setzen eines Stolpersteins zu schaffen. Wichtig im lokalen Kontext ist auch das Archiv des Friedhofs Ohlsdorf, wo Skworonski Forschungen durchführt.Bedeutend unter dem Aspekt der Verquickung von zivilem und militärischem Bereich im Zusammenhang mit Desertionen war Christiane Rothmalers Referat „’Weil ich Angst hatte, dass er erschossen wird’ – Die Bestrafung von Frauen wegen Beihilfe zur Fahnenflucht vor dem Hanseatischen Sondergericht“. Der Vortrag stützte sich auf ältere Forschungen (aus den 90er Jahren) ; neuere existieren nicht. Die Bedeutung des Themas besteht darin, dass das Phänomen der Desertion nicht einseitig dem militärischen Bereich zugeordnet werden darf und außerdem nicht allein dem der Männer, sondern dass es als sozialgeschichtliches Phänomen gesehen werden muss, insofern Flucht und Untertauchen ohne Helferinnen und Helfer nicht möglich war.
Eher illustrative Bedeutung hatte dagegen der Vortrag von Claudia Bade über „Hamburger Wehrmachtrichter: Karrieren und Rechtfertigungen“. Was die Forscherin berichtete, diente zwar der Anschaulichkeit, jedoch die großen Linien waren bereits bekannt – sowohl was die ideologische Nähe der Wehrmachtrichter der Kaiserzeit, die in der Weimarer Zeit kein Betätigungsfeld mehr hatten, zur NS-Ideologie anbelangte als auch die Kontinuität ihrer Karriere in der Nachkriegszeit, auch wenn sie in ihrem Bereich nicht weiterarbeiten konnten, weil die Militärjustiz in der Bundesrepublik abgeschafft ist. (Dieser Punkt gab allerdings Anlass zum Hinweis auf gegenwärtige Bestrebungen, sie wieder einzuführen.)
Innerhalb mancher dieser Vorträge gab es überdies Phasen, in denen ich mich fragte, welchen politischen Nutzen die detaillierte mündliche Darlegung von Zahlen und Fakten eigentlich habe. In seinem „Tagungskommentar: Ergebnisse und Ausblick“ am Sonnabendmittag warf Ulrich Hentschel von der Evangelischen Akademie meines Erachtens zu Recht die Frage auf, ob es dem Tagungsverlauf aus der Perspektive des Publikums nicht gut getan hätte, mehr Phasen der Besinnung zu haben, statt immer mehr Informationen aufnehmen zu müssen.
Dieses Problem betraf vor allem den sehr vollgestopften Freitag, 18.11. (Ich muss gestehen, dass ich es nicht mehr über mich brachte, nach den vielen Vorträgen mir auch noch um 19.30 im „Haus im Park“ in Bergedorf den Film „Ungehorsam als Tugend“ anzusehen, an den sich auch noch eine Diskussion schließen sollte.) Der Sonnabend, an dem die Tagung endete, brachte wieder viele Informationen, die für das Projekt der Errichtung eines Deserteursdenkmals am Kriegsklotz nützlich sein werden: Das gilt sowohl für Kerstin Klingels Überblick über Hamburger Krieger- und
Gegendenkmale
als auch für Karla Fings’ sehr instruktive Nachzeichnung des Arbeitsprozesses, der in Köln zur Einweihung eines Deserteursdenkmals am Appellhofplatz geführt hat (am Antikriegstag des Jahres 2009). Dieses Referat wäre einer ausführlichen Wiedergabe wert, die aber den gegebenen Rahmen sprengen würde. Für die am Projekt Beteiligten könnte es ein Leitfaden sein. Detlef Garbes Vortrag „25 Jahre weitgehend vergebliche Bemühungen
um ein Deserteursdenkmal in Hamburg“ skizzierte das Gegenbild zu dem, was Köln inzwischen besitzt, und markierte den Ausgangspunkt, von dem die Bemühungen in Hamburg starten können bzw. müssen.
Das Wort „weitgehend“ deutete an, dass nicht alle bisherigen Bemühungen vergeblich waren. An dieser Stelle wurden nun auch die Leistungen des „Bündnisses für ein Hamburger Deserteursdenkmal“ gewürdigt.
Nun gelangte schließlich auch die Rolle des Volksbunds deutsche Kriegsgräberfürsorge, LV Hamburg in den Fokus: Nachdem ein Teilnehmer aus Hannover der anwesenden Geschäftsführerin Oktavia Christ, die als Moderatorin fungierte, vorgehalten hatte, der Volksbund werde im kommenden Jahr, dem 60. Jahr seines Bestehens, zugeben müssen, dass es ihm in der gesamten Zeit nicht gelungen sei, auch nur ein einziges Mal einen Deserteur haben sprechen zu lassen, reagierte diese sichtlich betroffen. Nach den Informationen, die ich in meinem letzten LB-Artikel gegeben habe, muss sie sich zwischen Baum und Borke gefühlt haben. (Das Meinungsspektrum in ihrem Verband ist offenbar sehr breit.) Als anschließend René Senenko vom „Bündnis“ sich über mangelnde Zusammenarbeit des Volksbundes bis hin zu ausbleibenden Antwortschreiben beklagt hatte, entschuldigte sich Frau Christ und stellte bessere Zusammenarbeit in Aussicht. (Nach Auskunft von René Senenko hat der Verband inzwischen Kontakt zum „Bündnis aufgenommen.)
Ulrich Hentschels Tagungskommentar ist bereits kurz angesprochen worden. Pastor Hentschel stellte sich sympathischerweise als Lernenden inmitten von Fachleuten dar und legte das Schwergewicht auf theologisch-kirchliche Aspekte, was historisch-politische Stellungnahmen nicht ausschloss: Er wandte sich einerseits gegen eine falsche Glorifizierung der Deserteure der Wehrmacht und verwies andererseits darauf, dass als Minimalstandard der Beurteilung – selbst bei kriminellem Handeln eines Deserteurs – die Tatsache zu beachten sei, dass die NS-Militärjustiz unverhältnismäßig hart richtete; auch kleinste Vergehen konnten mit dem Tode bestraft werden: Also müssten selbst solche Deserteure in erster Linie als Opfer betrachtet werden.
Bemerkenswert fand ich, dass Hentschel die Frage aufnahm, wie das Thema der Desertion im Kontext der Kriegführung der Bundeswehr im Ausland (die meist verschleiernd als „Auslandseinsätze“ bezeichnend werden) sowie die Rolle der Militärgeistlichen zu beurteilen sei.
Im Gegensatz zur Eröffnungsveranstaltung am Donnerstagabend, als ein Offizier der Bundeswehr, der sich gleichzeitig als Historiker vorstellte, divergierende Auffassungen zumindest angedeutet hatte, blieben an den beiden anderen Tagen des Seminars Kontroversen fast vollständig aus. Ein Wermutstropfen, den Hentschel erwähnte, war die geringe Beteiligung an den Veranstaltungen.
Da sich während der Woche jedoch herausstellte, dass – entgegen dem ersten Anschein – die Veranstalter das „Bündnis“ wahrnahmen und seine Arbeit wertschätzten, ist zu hoffen, dass im Zusammenhang mit den politischen Aktivitäten aus der Bürgerschaft heraus die gemeinsame Arbeit auf das Ziel eines Deserteursdenkmals am Kriegsklotz die vorhandenen unterschiedlichen Kräfte wird bündeln können und dass sich ein Erfolg in nicht allzu weiter Ferne erreichen lässt.
Lothar Zieske