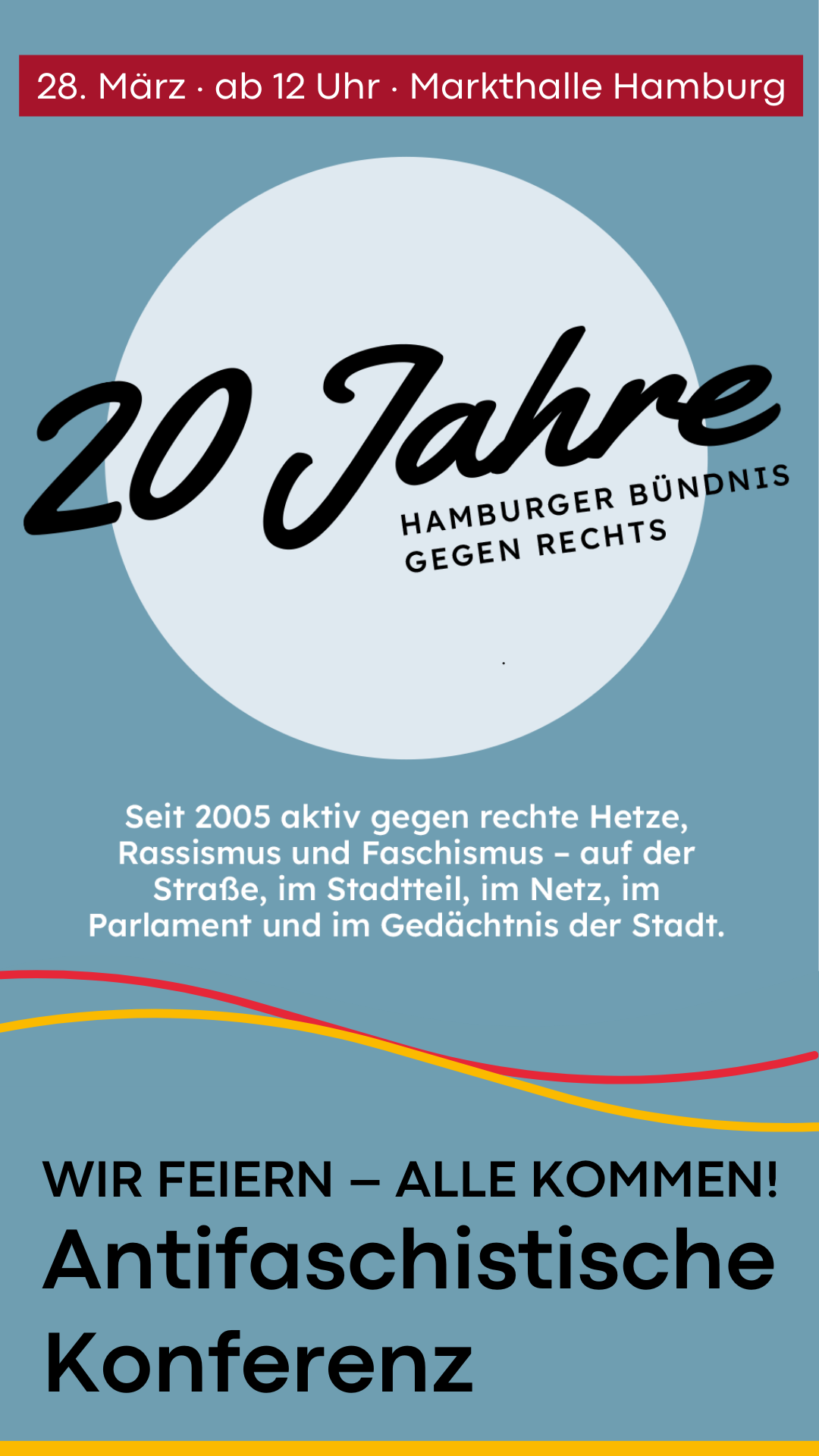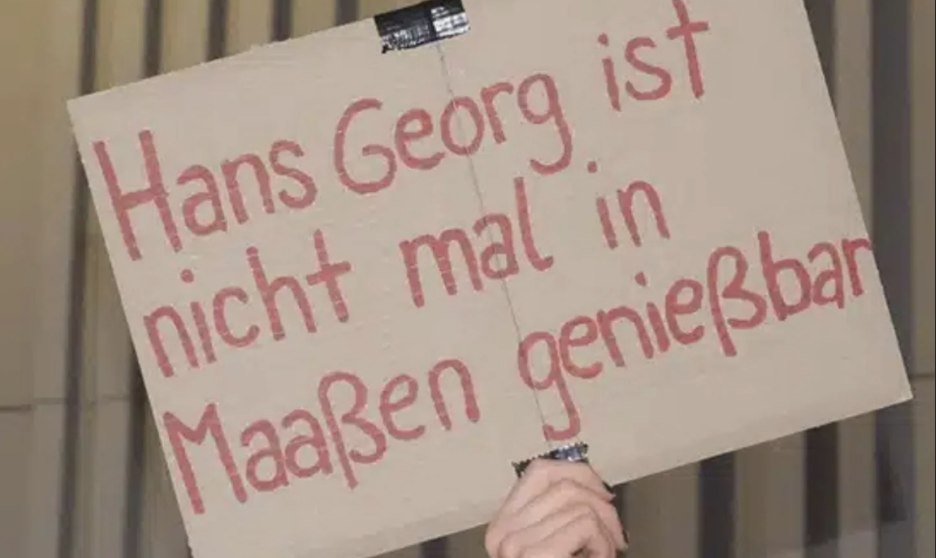von Lothar Zieske
Ein Bericht über eine Zeitzeugenveranstaltung in der Gedenkstätte Neuengamme
Gespräche mit Zeitzeugen, die von den Verbrechen in den KZs berichteten, gab es schon seit Jahrzehnten. In der Gedenkstätte des KZs Neuengamme gehören sie auch schon lange zum Veranstaltungsprogramm. Inzwischen leben immer weniger Menschen, die die Geschichte von Leiden und auch Widerstand oder Solidarität weitergeben können. Ihr Platz wird ersetzt werden müssen, wenn ihre Geschichte nicht in Vergessenheit geraten soll. In erster Linie sind nun ihre Nachkommen gefragt, wenn es um das Wachhalten der Erinnerung geht.
Für mich war es eine neue Erfahrung, eine Person als Zeitzeugen der faschistischen Verbrechen zu erleben, die fast genau gleichaltrig mit mir war: Étienne François, Sohn des Geschichtslehrers Jean François. Unwillkürlich dachte ich: „Die Zeitzeugen werden immer jünger.“
Jean François war im Juli 1944 als „Sonderhäftling“ aus dem KZ Compiègne mit etwa 400 weiteren Personen in des sogenannte „Prominentenlager“ des KZs Neuengamme überstellt worden. Bevor sein Sohn das Wort ergriff, stellte Christine Eckel, die die Veranstaltung moderierte, die Geschichte der französischen Häftlinge im KZ Neuengamme (fast 11 000 Personen, darunter etwa 650 Frauen) dar. Die Häftlinge des „Prominentenlagers“ waren, wie Jean François, nach der Landung der Alliierten in der Normandie (6. Juni 1944) festgenommen worden, da die deutsche Besatzungsmacht befürchtete, die Alliierten könnten durch Personen unterstützt werden, die in irgendeiner Weise Sympathien für die Résistance hatten erkennen lassen.
Jean François hatte auch im Unterricht aus seiner Abneigung gegen den Faschismus keinen Hehl gemacht. (Nach der Befreiung wurde einer seiner Schüler wegen Denunziation unter Anklage gestellt, doch das Verfahren erbrachte nichts Substanzielles.)
Die Häftlinge des „Prominentenlagers“ mussten keine Zwangsarbeit leisten und durften Zivilkleidung tragen, doch hatten sie, davon abgesehen, unter den übrigen Erniedrigungen und Entbehrungen genauso zu leiden wie die anderen. Am schlimmsten war es für Jean François, bei den öffentlichen Hinrichtungen anwesend sein zu müssen, die zudem noch zynischerweise unter Musikbegleitung stattfanden.
Gegen Kriegsende wurden sie nicht auf „Todesmärsche“ geschickt, sondern mit den ursprünglich nur für die skandinavischen Häftlinge vorgesehenen „Weißen Bussen“ evakuiert. Auf diese Weise gelangten sie über das inzwischen in Auflösung befindliche KZ Flossenbürg in die Nähe von Prag, wo sie befreit wurden.
Etienne François hat, wie sein Vater, Geschichte studiert und ist Professor dieses Faches geworden. Er hat in Deutschland und Frankreich gelehrt und geforscht, u.a. an der Sorbonne und an der FU Berlin. Umso erstaunlicher, dass er bislang weder vor Studierenden noch vor Schulklassen über die Geschichte seines Vaters berichtet hatte. Trotzdem wirkte er während des Gesprächs unbefangen und dazu noch überaus freundlich.
Er berichtete zunächst, dass er erst zwei Jahre alt war, als sein Vater im Juli 1945 zurückkehrte. Er soll von dessen Anwesenheit gar nicht erbaut gewesen sein, sei ihm berichtet worden. In Freudscher Manier erklärte er das damit, dass er „entthront“ worden sei, da er nun seine Mutter nicht mehr für sich allein gehabt habe. (Ich konnte nicht umhin, ihm nach der Veranstaltung mitzuteilen, dass ich in seinem Alter Ähnliches erlebt hätte: Als mein Vater – allerdings noch in Uniform und dazu mit einem Kameraden – aus der Kriegsgefangenschaft zurückgekehrt sei, soll ich, nachdem ich längere Zeit tief eingeatmet hätte, gebrüllt haben wie am Spieß.)
Als Historiker hielt es Jean François für wichtig, seinen Kindern so früh wie möglich, seine Erfahrungen mitzuteilen, und Etienne, als der Älteste, erfuhr am frühesten und am meisten davon. Der erste deutsche Ortsname, den er hörte, war „Neuengamme“. Oft war von „KL“ die Rede. (Die Bezeichnung „KZ“ lernte er erst nachträglich kennen. Bis dahin empörte er sich darüber, dass in der BRD das Autokennzeichen „KL“ für „Kaiserslautern“ vergeben wurde.) „KL“ tauchte im alltäglichen Wortschatz der Familie bald häufig auf; die Kinder gebrauchten die Abkürzung, wenn etwas als unzumutbar bezeichnen wollten.
Étienne François fasste die Erfahrungen seines Vaters in wenigen Hauptpunkten zusammen: Der erste hatte einen Zusammenhang mit dem Grund dafür, weshalb sein Vater überhaupt in das „Prominentenlager“, mit seinen relativen Vergünstigungen, gelangt war: der „Titelsucht der Deutschen“ wegen (wie er es nannte). Als Beruf hatte er angegeben „professeur aggrégé de l’ université du lycée“, was nichts anderes bedeutete als „Gymnasiallehrer“. Die Nazis sahen hingegen das Wort „professeur“ als Äquivalent für „Professor“ an.
Die Erfahrungen, die Jean François mit den „Prominenten“ machte, erbitterten ihn jedoch sehr; er sprach von freiwilligem Verzicht auf Selbstachtung. Besonders erzürnte es ihn, dass einige Honoratioren das Brot der anderen stahlen. Er schärfte seinem Sohn ein: „Sei misstrauisch gegenüber Titeln!“ Als ich in der Diskussion argumentierte, die Erniedrigung sei doch in erster Linie den Faschisten zuzurechnen, bestand Etienne François auf der Verantwortlichkeit auch der Häftlinge: Nicht, dass einzelne ihre Würde überhaupt abgegeben hatten, sei zu kritisieren, sondern dass sie es so schnell getan hätten.
War diese Sicht des Vaters Jean François, die der Sohn teilte, für mich schon erstaunlich, galt dies umso mehr für eine andere: Er unterschied scharf zwischen Deutschen und Nazis und entschloss sich, im KZ Neuengamme Deutsch zu lernen. Er ließ seine Kinder später in der Schule Deutsch lernen. Allerdings verfiel er nicht ins Extrem, alles vergessen und verzeihen zu wollen, was in Neuengamme geschehen war: Als der Sohn von seinem ersten Aufenthalt in der BRD zurückkehrte, riet er ihm dann doch, den schwarz-rot-goldenen Aufnäher von seinem Rucksack wieder zu entfernen.Dass Jean François so viel aus der Zeit seiner Lagerhaft berichtet, war nicht selbstverständlich. Sein Sohn erklärt dies damit, dass er meint, der Vater sei doch wohl stärker traumatisiert gewesen, als er habe erkennen lassen wollen; vielleicht habe er deswegen so viel erzählt, weil er gehofft habe, seine Häftlingszeit habe Vergangenheit werden mögen. Für seine These von unterdrückter Traumatisierung spreche auch, dass der Vater in den 50er und 60er Jahren immer skeptischer in Hinblick auf die politische Entwicklung geworden sei; seine Hoffnung, der Faschismus sei ausgerottet, sei schwächer geworden.
Desillusioniert worden sei der Vater zusätzlich dadurch, dass er in Archiven viel über Denunziationen in Frankreich zur Zeit der Besetzung gelesen habe. Nach Neuengamme sei er nie wieder zurückgekommen. (Er starb bereits 1965, im Alter von nur 51 Jahren.) Étiennes Mutter hingegen besuchte die Gedenkstätte mit ihm im Jahre 1995, was für sie sehr wichtig gewesen sei. Nach der Verhaftung ihres Mannes hatte sie nicht erfahren, was mit ihm geschehen war. Aus Neuengamme hatte er lediglich seinem in Lübeck gefangenen Bruder schreiben, der seine Nachricht aber nicht hatte weitergeben können. Die Mutter konnte mit dem Besuch in der
Gedenkstätte
das Kreisen ihrer Gedanken über diese Phase im Leben ihres Mannes zur Ruhe bringen, der in der noch von ihm formulierten Todesanzeige außer seinem Namen nur zwei Worte hatte stehen haben wollen: „professeur“ und „déporté“.
Auf das zeitweilig sehr gespannte Verhältnis der ehemaligen Häftlinge aus dem „Prominentenlager“ und der „Amicale Internationale
de Neuengamme“ angesprochen, und gefragt, ob er sich nicht dieser AIN anschließen wollen, antwortete Étienne François: „Ich war kein Deportierter“. Diese Antwort sagt viel über die Frage, ob sich KZ-Erfahrungen überhaupt weitergeben lassen oder ob sie nicht letztlich bei den Deportierten eingeschlossen bleiben werden.