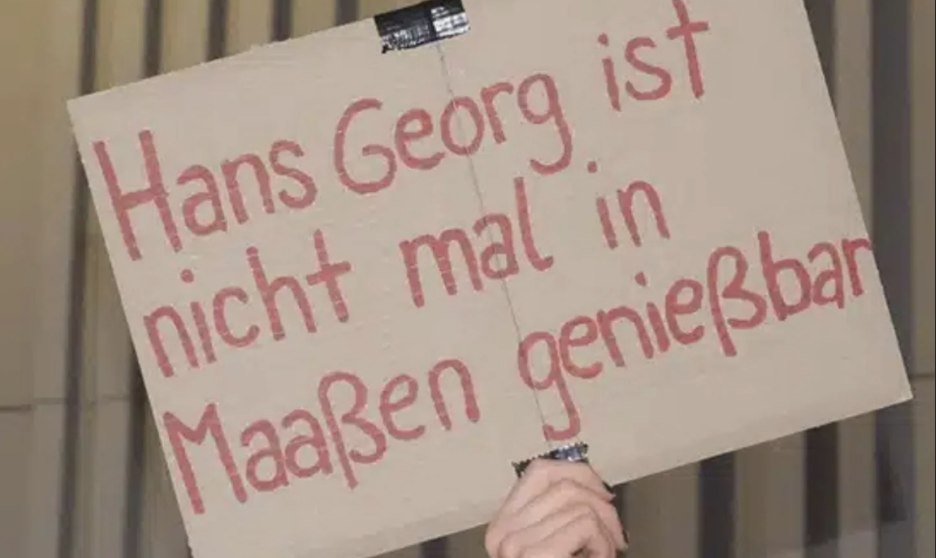Indymedia, Kombinat Fortschritt 27. Aug. 20120
Nachdem bereits gestern etwa 6000 Menschen gegen die Rostocker Geschichtsvergessenheit und die noch immer gegenwärtigen rassistischen Zustände nicht allein an den Außengrenzen der Europäischen Union, sondern vor allem der vermeintlichen gesellschaftlichen Mitte intervenierten, sollte heute Bundespräsident Joachim Gauck Gelegenheit bekommen, sich zu den Pogromnächten und vor allem dem Umgang mit diesen im kollektiven Gedächtnis einer Stadt, ihrer Bewohner_innen und der Bundesrepublik zu äußern. Etwas versteckt auf der Rückseite des Sonnenblumenhauses, zwischen einer "deutschen Eiche", Bierwägen, Bratwurst-Ständen und einem Zirkuszelt, zelebrierte dieser jedoch vor allem Rostock als übermächtigte und längst geläuterte Stadt, die aus den "Fehlern und Versäumnissen" gelernt habe und in welcher nun die "Leitmelodie für ein lebenswertes und liebenswertes Deutschland" erklinge. Neben dieser nun inzwischen 20 Jahre währenden Abwehr der Anerkennung dessen, was sich in Lichtenhagen Bahnen brach, traten am Rande des "Festaktes" die Strukturen an die Gauck würdig erinnern sollte erneut offen zu Tage. So versuchten "gemäßigte Demonstranten", wie es im Kurzbericht des NDR heißt, antirassistische Interventionen zu unterbinden und die Veranstalter verspürten offenbar ebenfalls keine Scham, bereits geladene Gäste unbegründet abzuweisen.
Handgreiflichkeiten und christliche Ethik im "Jahr des Handelns"
Wer gehofft hatte, dass hinter dem "Sonnenblumenhaus" auch ein Blick hinter den Rostocker Erinnerungsdiskurs geworfen werden sollte,wurde bitter enttäuscht. Dass sowohl Veranstalter_innen als auch Schaulustigen mehr an der Kontinuität des Verdrängens gelegen ist, denn an einer Aufarbeitung unterstrich nicht allein die Inszenierung dieses "Festaktes" anlässlich des 20. Jahrestages des Pogroms in Rostock-Lichtenhagen, die zwischen mahnenden Worten und Spektakel changierte, sondern vor allem Redner_innen und Publikum selbst.
Nachdem außerhalb des Bereichs geladener Gäste zeitweise etwa 50 Menschen durch vielfältige Störaktionen auf sich aufmerksam machten, schlug das Unterbewusste einiger Rostocker_innen offenbar zurück. Während die Einen noch darauf hinwiesen, dass die Rede des evangelischen Pfarrers kaum zu verstehen sei, zerrten andere wütend an einem Transparent, auf welchem offen gezeigt wurde, was alle Welt 1992 live miterleben konnte: Rassismus tötet. Die Beschreibung als "gemäßigte Demonstranten", welche der NDR für sie wählte, erscheint vor dem Hintergrund ihrer Aktivität bezeichnend. Denn was sie demonstrierten, war der Wunsch nach der Verdrängung, nach Harmonie und vor allem nach Ruhe in ihrer randstädtischen Gemeinschaft.
Der Bundespräsident selbst, der meint, dass Thilos Sarrazin "nicht ein Problem erfunden hat", versöhnte den Rostocker Wunsch nach Verdrängung mit jenem nach einem vermeintlich "liebenswerten Deutschland" auf seine ganz eigene, evangelisch angehauchte Weise. Nachdem auch er die Pogromnächte zu "ausländerfeindlichen Ausschreitungen" bagatellisierte und damit den Versuch des rassistischen Mobs zu töten verschwieg, stilisierte er eine protestantische Ethik, die offenbar keiner Praxis bedarf, zum Heilmittel einer Gegenwart, die "infiziert von Fremdenfeindlichkeit, Hass, Gewalt [bleibt]." Am Pogrom hätten sich die Lichtenhägener_innen selbst lediglich als "gewalttätige Jugendliche" oder Publikum beteiligt, der rassistische Impuls hingegen sei vor allem von "Randalierern und Rechtsextremen aus Ost- und Westdeutschland" ausgegangen. So sei Gauck zwar entzürnt über den Beifall des Mobs von 1992, erteilt dem selben jedoch umgekehrt Absolution, da der "Fremdenhass", sofern er nicht vollständig von außen hereingetragen worden sei, vor allem auf einem mangelnden Kontakt ostdeutschen Bürger_innen mit jenen vermeintlichen Fremden zurückzuführen sei. Lediglich aus der "Verzweiflung" heraus hätten diese nicht "HERR, hilf uns!" gerufen, sondern jedem Molotow Cocktail bejubelt. Und in eben jenem Tenor beschrieb Gauck dann auch die Verantwortung der Gegenwart. So sei 2012 das "Jahr des Handelns", eine Zeit, in welcher Politik nicht allein guter Ansätze bedürfe, sondern in die Praxis überführt werden solle, welche Gauck auch sofort an einem Beispiel ausführte:
"Als Vertreter eines offenen und hilfsbereiten Deutschland sehe ich hier allerdings ehemalige Mitstreiter: Sie waren dabei, als das Neue Forum am 27. August 1992 gemeinsam mit den Rostocker Kirchen einen Schweigemarsch und Friedensgebete organisiert hat. 'Zündet Kerzen an und keine Häuser!', stand auf den Plakaten dieser schon damals bewegten Bürgerinnen und Bürger. Lichtenhagen bewegt sich nicht erst heute, wie es hier oben steht. Lichtenhagen hat sich schon damals bewegt. Auch daran wollen wir heute erinnern."
Die Verantwortung bestünde folglich weniger in der Kritik an und Intervention gegen unhaltbare Zustände, sondern vielmehr in der Anrufung des Herrn. Zwar könne "eine völlig gereinigte Gesellschaft" nicht erreicht werden, jedoch eine solidarische Gegenwart. Kein Wort verlor Bundespräsident Gauck jedoch über die Solidarität, welche den Opfern der Pogrome der frühen 1990er Jahre zu Teil wurde: die Abschiebung und ihre Instrumentalisierung zur faktischen Abschaffung des Grundrechts auf Asyl.
"Warum dürfen wir nicht hier rein?"
Am Rande dieser offiziellen Veranstaltung mit dem neu ernannten Ehrenbürger scheint sich jedoch die Kontinuität der Fratze des Rostocker Erinnerungsdiskurses gezeigt zu haben. Zwei Mitglieder des deutsch-afrikanischen Freundeskreises Daraja e. V., unter ihnen das Vorstandsmitglied Marouf Ali Yarou Issah, hatten sich bereits vor Wochen für die Gedenkveranstaltung mit Joachim Gauck angemeldet – zunächst auch mit Erfolg. Über eine halbe Stunde vor Veranstaltungsbeginn fanden sie sich mit ihrer Einladung auf dem Gelände ein. Doch bereits am Einlass wurde der Zutritt zum Festakt hinausgezögert. Zunächst kein ungewöhnliches Unterfangen bedenkt man die hohen Sicherheitsvorkehrungen, die für die Anreise des Bundespräsidenten getroffen werden. Doch nachdem die Sicherheitsbeamten mit den Veranstaltern Rücksprache hielten, wurde den geladenen Gästen plötzlich mitgeteilt, dass sie auf der Veranstaltung nicht erwünscht seien, genauere Begründungen für dieses Vorgehen blieben jedoch aus. Auch auf explizit gestellte Nachfragen erhielten die ausgeladenen Gäste keine Auskunft, nur eine scheinheilige Begründung, dass sie auf dem Gelände wohl zu spät eingetroffen seien. Eine Farce, denn auch nach der Abweisung konnten offenbar weitere Geladene die Schleuse passieren.
Die Vermutung liegt nahe, dass sich auch 20 Jahre nach Rostock-Lichtenhagen kein gravierender Sinneswandel vollzog, da sich Vertreter der Stadt vorurteilsbehaftet entschieden mit wem sie gemeinsam den Festakt zelebrieren. Erst im Anschluss an die Veranstaltung wurde der Zugang zum Gelände freigegeben und eine Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten versprochen. Der faktische Ausschluss der geladenen Gäste zeigt jedoch die Grenzen der vor laufenden Kamera zelebrierten Vielfalt. Denn an einen unglücklichen Umstand oder einem Fehler im Protokoll mag in diesem Zusammenhang niemand glauben. Die Selbststilisierung Rostocks als geläuterte Stadt erscheint auch vor diesem Hintergrund als Imagekampagne, die jedoch immer wieder von den eigenen Denkmustern demaskiert wird. Schließlich symbolisiert auch die Pflanzung einer deutschen Eiche als Mahnmal vor allem die gewollte Standhaftigkeit der deutschen Leitkultur.
Quelle