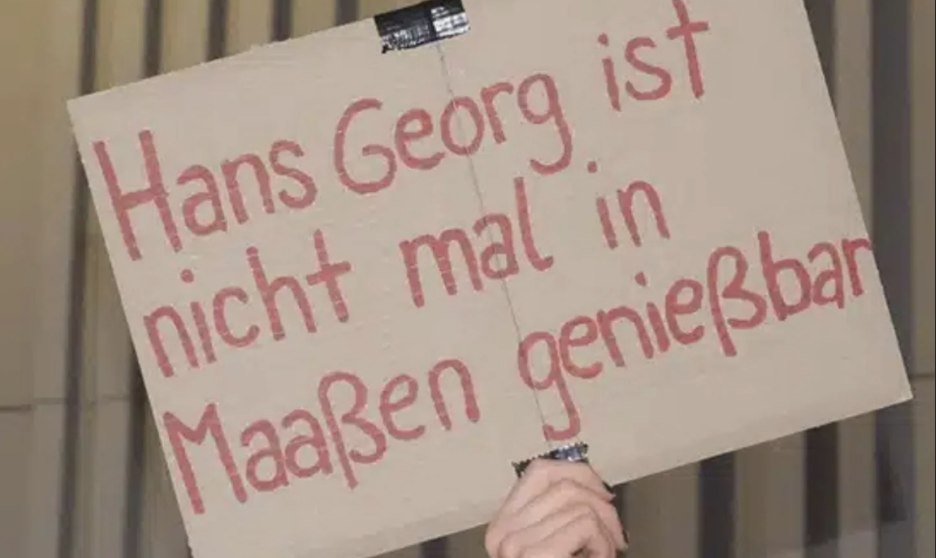„Das Kulturprogramm wird verschoben“
von Lothar Zieske
Wieder ist dem Auschwitz-Komitee am 20. Januar eine Veranstaltung gelungen, die an den „Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz durch die Rote Armee am 27. Januar 1945“ erinnern sollte. Auschwitz ist als Symbol für den „Zivilisationsbruch“ bezeichnet worden, den die deutschen Faschisten durch die Vernichtung der Juden, Sinti und Roma sowie anderer von ihnen definierter Feindgruppen begangen haben. Auschwitz ist aber nicht nur als Symbol, sondern als Ort im allgemeinen Bewusstsein verankert, wo die Verbrechen der Shoah und des Porajmos (so die Bezeichnung des Völkermords an den Sinti und Roma in ihrer eigenen Sprache) geschahen.
Der Name des Vernichtungslagers Belzec, das im Rahmen der „Aktion Reinhardt“ errichtet und betrieben wurde, ist hierzulande dagegen fast unbekannt. Dabei wurden dort (laut Wikipedia) „zwischen März 1942 und Dezember 1942 nachweisbar 434.508 Menschen ermordet“. 1940 wurde in Belzec zunächst ein Arbeitslager errichtet; in dieser Funktion wurde dort auch die Infrastruktur des späteren Vernichtungslagers von Häftlingen aufgebaut.
Das Auschwitz-Komitee wollte den Namen Belzec dem Vergessen entreißen und hatte deshalb ein ambitioniertes Programm vorbereitet, in das der ursprünglich vorgesehene Vortrag von Liedern nach Texten Erich Mühsams nicht mehr hineinpasste.
Der Nachmittag verlangte den Personen auf dem Podium und dem Publikum viel ab. Leichter war das Ziel der Veranstaltung aber wohl nicht zu erreichen. Esther Bejarano, die in ihrer Begrüßungsansprache erwähnt hatte, dass ihre Eltern bei Kowno und eine ihrer Schwestern, Ruth, an der deutsch-schweizerischen Grenze erschossen worden waren, schenkte sich nichts und las anschließend Zeitzeugenberichte vor, die vom Vernichtungslager Belzec handelten. Sie waren einem in deutscher Übersetzung neu erschienenen Buch des polnischen Historikers Robert Kuwalek entnommen, der anschließend auf dem Podium das Wort ergriff.[1] Er stellte die Schrecken der Zeitzeugenberichte in den historischen Kontext. Sie in Einzelheiten wiederzugeben, würde zu weit führen. Es mag genügen, sich vorzustellen, wie eine Lagermannschaft gewütet haben muss, die in einem Dreivierteljahr mehr als 400 000 Menschen ermordete, wobei es nur 3 – in Worten: drei – Überlebende gab.
Nach der Pause beantworteten Kuwalek und Ewa Koper (pädagogische Mitarbeiterin der Gedenkstätte Belzec) Fragen, die ihnen von zwei Mitgliedern des Auschwitz-Komitees, Heidburg Behling und Susanne Kondoch-Klockow, gestellt wurden. Eine große Rolle spielte dabei die Frage, wie es möglich war, dass das Lager etwa 50 Jahre lang fast der Vergessenheit anheim gefallen war. In diesem Zusammenhang wäre es wünschenswert gewesen, wenn seine Geschichte unmittelbar nach Beendigung des Massenmordes dargestellt worden wäre, wie es vor etwa zehn Jahren im Begleittext zu einer Veranstaltung mit dem britischen Historiker Michael Tregenza geschah[2]. Im Einladungsflugblatt hieß es: „Zwischen Dezember 1942 und Frühling 1943 wurden die Massengräber in Belzec geöffnet und die Leichen der Opfer exhumiert und verbrannt. Knochenreste wurden zermalmt und zusammen mit der Asche in den Gräbern verscharrt, aus denen die Leichen entfernt worden waren. Als die Verbrennung der Leichen abgeschlossen war, wurde das Lager abgerissen; alle sichtbaren Spuren des Massenmordes wurden entfernt.“ Die Feindseligkeit der örtlichen Bevölkerung den Juden gegenüber, die Tragenza bis in die Gegenwart feststellen musste, tauchte in der Antwort Kopers und Kuwaleks eher indirekt auf, indem davon die Rede war, dass die jüdische Bevölkerung Polen nach 1945 fast vollständig verließ.
Zwar ist es erfreulich, wie intensiv die Bildung- und die Forschungsarbeit in und über Belzec inzwischen im Rahmen einer Gedenkstätte betrieben wird, es wäre aber gut gewesen, mehr über den Hintergrund zu erfahren, auf dem sie sich entwickelte.
Der letzte Teil der Veranstaltung stellte dann einen dramatischen Schlusspunkt dar: Robert Weiß, Vorsitzender des Landesvereins der Sinti in Hamburg berichtete von den Erinnerungen an Belzec, die sein Vater Rigoletto ihm stückweise mitgeteilt hatte – Erinnerungen, die ihn und auch den Sohn verfolgten. Rigoletto Weiß war im Arbeitslager Belzec eingesetzt worden. Die Geschichte der Deportation der Sinti und Roma nach und von Belzec war durch die Perfidie der Faschisten geprägt, die den ihnen bekannten Familiensinn der Sinti und Roma ausnutzten, um sie erfassen und täuschen zu können: Ihnen wurde Land im Osten versprochen, das sie im familiären Zusammenhang bearbeiten könnten; später, als sie in Belzec ihre Aufgabe erledigt hatten, wurde ihnen vorgegaukelt, sie könnten wieder in ihren familiären Zusammenhang gelangen, wenn sie sich entschlössen, sich nach Auschwitz deportieren zu lassen. Dass dies nur den gemeinsamen Tod, nicht etwa ein gemeinsames Leben bedeuten würde, ahnten einige der Älteren bereits und warnten. Wie Recht sie gehabt hatten, zeigte sich, als die Nazis das „Zigeunerlager“ in Auschwitz Anfang August 1944 räumten und die dort zusammengefassten Menschen ermordeten.
Robert Weiß gab der Veranstaltung eine politische Note, indem er die Lehren aus dem Leiden der Sinti und Roma zog: Seine Familie lebt schon seit vielen Jahrhunderten in Harburg. Trotzdem stellte sich eine Frau, die von ihm wissen wollte, was ein Sinto sei, darunter einen Mann mit dunkler Haut, öligen Haaren und Schnurrbart vor, der die Tracht seines Volkes trage. Robert Weiß stellte dagegen: Ein Sinto wird als das gesehen, was sich die Mehrheitsgesellschaft unter einem Sinto vorstellt. In Wirklichkeit ist er aber – so Robert Weiß – ganz einfach ein Mensch, so wie wir alle nur Menschen sind. Alles andere seien künstliche Einteilungen. So entwickelte er die bekannte Devise „Kein Mensch ist illegal“ aus der Geschichte seiner Familie. Das Publikum applaudierte. Abschließend erinnerte er an das christliche Gebot der Nächstenliebe („Liebe deinen Nächsten wie dich selbst.“). „Und“ – fragte er rhetorisch: „Wer will sich denn selbst schaden?“ Noch größerer Beifall beendete die Veranstaltung.
Großen Anteil an deren Erfolg hatten außer den bisher genannten Personen insbesondere Helga Obens, die engagiert und einfühlsam moderierte, und Moritz Terfloth, der Robert Weiß nach seiner Familiengeschichte befragte und nicht zuletzt der hervorragende Übersetzer, dessen Namen ich leider nicht weiß.
Lothar
Zieske
[1] Robert Kuwalek: Das Vernichtungslager Belzec, Metropol Verlag Berlin 2013, 392 S., 24 €.
[2] http://www.nadir.org/nadir/aktuell/2002/08/29/12000.html . – Tregenza hielt seinen Vortrag am 17. September 2002 im Kölibri.