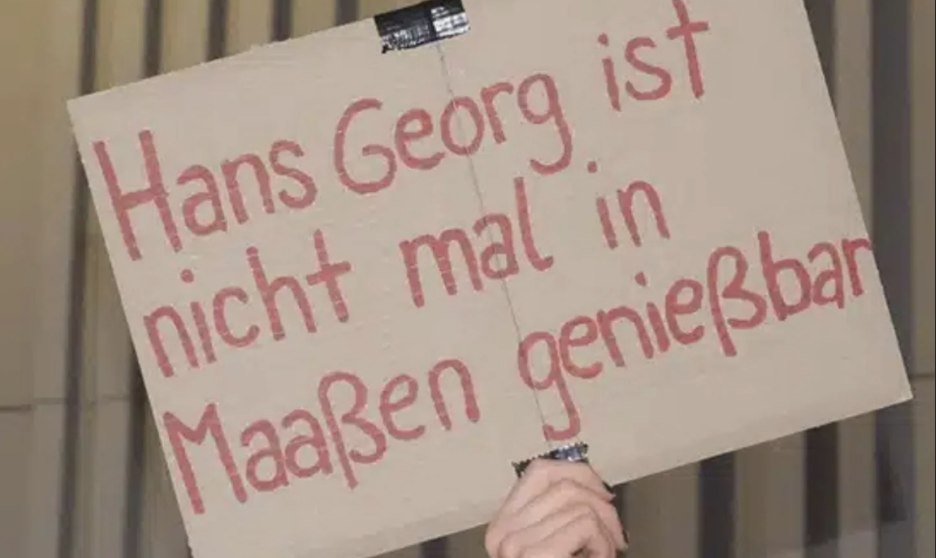von Lothar Zieske
Die vielfältigen Bemühungen des Hamburger „Bündnisses für ein Deserteursdenkmal“ haben in der Zwischenzeit zu einigen Erfolgen geführt. Der größte besteht darin, dass die Bürgerschaft im Juni 2012 einstimmig beschloss, dass ein solches Denkmal (aller Wahrscheinlichkeit nach) am Ort des „Kriegsklotzes“ entstehen und dass zu diesem Zweck ein Beirat gebildet werden solle. In Zusammenhang mit dessen Tätigkeit konnte am 25.Januar im Rathaus eine Ausstellung „Deserteure und andere Opfer der NS-Militärjustiz – Die Wehrmachtsgerichtsbarkeit in Hamburg“ eröffnet werden.
Die Reden, die bei dieser Gelegenheit gehalten wurden, waren keine Festreden im üblichen Sinne; dafür war das Thema der Ausstellung zu verstörend. So sollen im Folgenden auch nur diese Aspekte betrachtet werden.
Die Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit (SPD) hob hervor, dass die wissenschaftliche Beschäftigung mit der Geschichte der Wehrmachtsdeserteure erst sehr spät Fahrt aufnahm. Sie nannte ein bemerkenswertes Detail aus der unrühmliches Geschichte der Auseinandersetzung Hamburgs mit dem Faschismus: 1956 schloss die Regierung des „Hamburg-Blocks“ aus CDU, FDP und DP die „Forschungsstelle für die Geschichte Hamburgs von 1933 bis 1945“. Erst 1960 wurde sie unter dem Namen „Forschungsstelle für die Geschichte des Nationalsozialismus in Hamburg“ neu eingerichtet.
Dieses Detail leuchtet den Hintergrund aus, auf dem sich die Diskriminierung der Deserteure bis in die 80er Jahre abspielte. Diese war neben der Geschichte seiner Desertion, Verurteilung und seinem Überleben des Krieges eine verheerende Erfahrung in Ludwig Baumanns Leben. Er gehörte zu den Gründern der Bundesvereinigung Opfer der NS-Militärjustiz und seine bewegenden Zeitzeugenberichte haben wesentlich dazu beigetragen, dass die Bürgerschaft im Juni 2012 ihren Beschluss in bemerkenswerter Einstimmigkeit fällte. Baumann scheute sich nicht, ein Detail der wechselhaften Vorgeschichte der Rehabilitierung der Deserteure in Erinnerung zu rufen, das den anwesenden SozialdemokratInnen sicher Bauchschmerzen bereitet haben wird: Die PDS hatte im Bundestag einen Antrag der SPD aufgenommen, der sich für die Rehabilitation der Deserteure aussprach. Daraufhin gab die SPD reflexhaft zu Protokoll, dieser Antrag sei das Papier nicht wert, auf das er geschrieben sei. Ludwig Baumann erwähnte auch, dass die Bemühungen um die Rehabilitation unter der rot-grünen Bundesregierung einen Rückschlag erlitten, als/ weil diese den Jugoslawienkrieg führte. Damit wurde ein weiteres Mal deutlich, dass die Rehabilitation der Deserteure bis zu ihrer Durchsetzung ein brisantes Thema war; Vertreter der Bundeswehr pflegten einzuwenden, dass auf diese Weise die Bundeswehrsoldaten zu Verbrechern gestempelt würden. Um diesen Einwand zu widerlegen, brauchte Ludwig Baumann nur zu fragen, ob sie sich nicht von der Wehrmacht unterschieden.
An die bewegende Rede Baumanns schloss sich eine ebenso bewegende Rede Roland Sérazins an, des Sohnes von France Bloch-Sérazins und Frédo Sérazins. Beide hatten in der Résistance gekämpft und beide mussten ihren Widerstand mit dem Leben bezahlen: Der Vater starb in Frankreich nach Folterungen in deutscher Haft. Die Mutter wurde von Frankreich nach Lübeck ins Gefängnis gebracht und schließlich in Hamburg enthauptet.
Der Sohn hielt seine Rede auf Deutsch. Zu Beginn seiner Rede sagte er: „Das erste Mal, als ich nach Hamburg kam, war es im Februar 1988. Ich sprach kein Deutsch, ich wollte nichts mit Deutschland zu tun haben. Ich war in Hamburg, um eine Gedenktafel in Erinnerung an meine Mutter, France Bloch]Sérazin, einzuweihen.“ Seine Rede endete folgendermaßen: „Und plötzlich, in den achtziger Jahren, habe ich zwei Deutsche, Hans und Gerda Zorn, kennen gelernt. Hans wollte ein Buch über meine Mutter schreiben. In Deutschland, auf Deutsch! Für mich, nur gute Gründe um abzulehnen… Aber ich sagte dennoch: ‚Ja!‘ Hans und Gerda sind meine Freunde geworden. [ … ] Heute wurde ich hier für die Ausstellungseröffnung eingeladen. Es ist eine Ehre für mich und ich freue mich, dass deutsche Historiker heutzutage eine solche Gedächtnisarbeit machen. Und auch freue ich mich, erneut in Hamburg zu sein, um meine Freunde zu besuchen!“
Das liest sich, als ob nun alles wieder gut sei. Denjenigen, die bei Roland Sérazins Rede anwesend waren, wird klar sein, dass davon natürlich keine Rede sein kann.
Detlef Garbe, der Leiter der KZ-Gedenkstätte Neuengamme, hob schließlich hervor, dass erst die letzten zehn Jahre den Durchbruch in der Geschichtsschreibung zu den Deserteuren der Wehrmacht, den „Wehrkraftzersetzern“ und „Kriegsverrätern“ gebracht haben; in dieser Zeit waren zunächst die beiden ersten Gruppen und schließlich im Jahre 2009 rehabilitiert worden.
Lothar Zieske Zur Broschüre:
Detlef Garbe, Magnus Koch, Lars Skowronski unter Mitarbeit von Claudia Bade: Deserteure und andere Verfolgte der NS-Militärjustiz: Die Wehrmachtsgerichtsbarkeit in Hamburg,
66 S., Hamburg 2013. (E-Mail: info@kz-gedenkstaette-neuengamme.de )Die Broschüre wurde, wie die Ausstellung, von der KZ-Gedenkstätte Neuengamme erstellt. Sie verbindet allgemeine Informationen mit regionalen Informationen.
Zunächst wird die Entwicklung der Wehrmachtsjustiz vom Ersten Weltkrieg über deren Abschaffung in der Weimarer Republik bis zu ihrer Wiedereinführung am 12. Mai 1933, anschließend ihre Entwicklung in Form der Kriegssonderstrafrechtsverordnung (KSSVO) vom 17. August 1938 dargestellt.
Den Übergang zu den Fallbeispielen bildet der Abschnitt über die wichtige Rolle Hamburgs im Rahmen der NS-Militärjustiz (als Garnisons- und Gerichtsstandort, als Hafen und als Sitz bedeutender Kriegsindustrie).
Die Fallbeispiele stellen zunächst die Akteure der Wehrmachtsjustiz und dann die Schicksale ihrer Opfer dar. Hier geht es nicht nur um Deserteure, sondern auch um sogenannte „Wehrkraftzersetzer“. Opfer waren nicht nur Soldaten, sondern auch Mitglieder des sogenannten „Gefolges“, nicht nur Deutsche, sondern z. B. auch ein Norweger und eine französische Widerstandskämpferin.
Ein wichtiges, sattsam bekanntes Kapitel schließt das Heft ab: die Straffreiheit von Wehrmachtsrichtern und Denunzianten einerseits, die Diffamierung der Opfer und der meist vergebliche Kampf ihrer Angehörigen um Entschädigung und um die Rehabilitierung der Opfer. (lz)