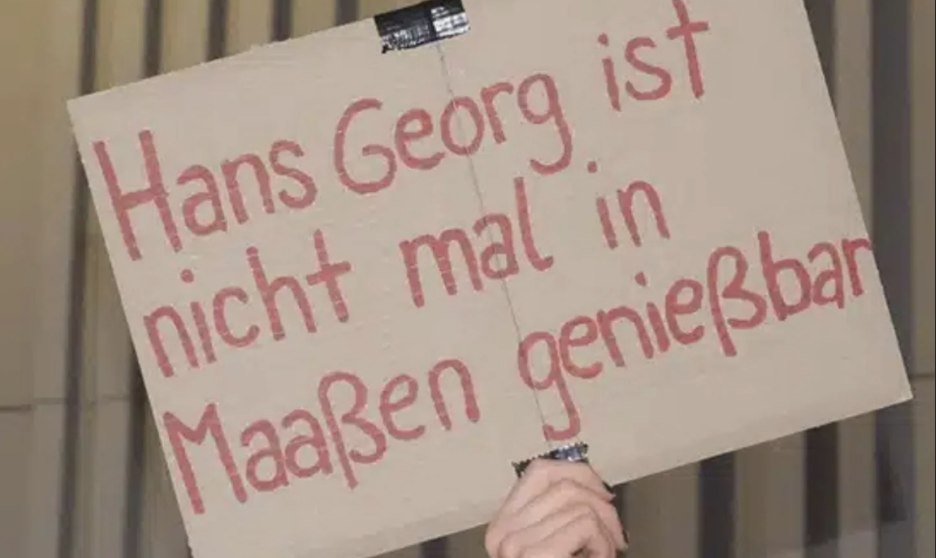Von Lothar Zieske
I
Es ist ein glücklicher Zufall, dass, während gerade der Film über Hannah Arendt mit großem Erfolg im Kino läuft, im Leo-Liepmann-Saal der Finanzbehörde eine Ausstellung über den Eichmann-Prozess in Jerusalem gezeigt wurde (vom 30. Januar bis zum 24. Februar). Der Zufall wäre allerdings weniger glücklich gewesen, wenn die genannte Ausstellung nicht von etlichen Vorträgen begleitet gewesen wäre. Denn leider muss gesagt werden, dass die Ausstellung, die von der Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem stammt, nur einen geringen Umfang hat und daher auch nicht sehr informativ ist. Ohne eine Führung hätte sich zumindest für mich der Besuch dieser Ausstellung nicht sehr gelohnt.
Nun wurde aber die Ausstellung von einem Programm begleitet, zu dem nicht nur die besagten Führungen, sondern auch noch etliche Vorträge gehörten. Durch die Ausstellung führte Bettina Stangneth, der es hervorragend gelang, die Exponate zum Sprechen zu bringen. Die promovierte Philosophin hat sich durch Veröffentlichungen zu Eichmann und zu dem Jerusalemer Prozess als Kennerin der Materie ausgewiesen. Die Kenntnisse, die sie komprimiert in ihre Erläuterungen einbrachte, breitete sie außerdem in einem Vortrag (am 7.2.) aus, in dem sie auch begründete, von welchem Interesse sie am Beginn ihrer inzwischen zehnjährigen Beschäftigung mit dem Thema ausgegangen war: das Thema „Lüge“ unter erkenntnistheoretischen Gesichtspunkten zu untersuchen. Eichmann schien ihr – wie sich zeigte – zu Recht als geeignetes Objekt. Ihr Vortrag hatte den Titel „Eichmann hinter den Spiegeln“. Er befasste sich nicht allein mit der Person Eichmanns, sondern auch mit dem inzwischen wieder stark in den Mittelpunkt gerückten Buch Hannah Arendts „Eichmann in Jerusalem“. (Sie arbeitet an einer historisch-kritischen Ausgabe dieses Buches.)
Der „Rote Faden“ ihrer Darlegungen war, dass Eichmann – nicht erst in Jerusalem, sondern bereits vom Beginn seiner Laufbahn an – ein Netz von Lügen und Manipulationen spann, in das er in der NS-Zeit sowohl seine Kollegen aus dem faschistischen Apparat als auch die Juden, mit denen er sprach, in Jerusalem Prozessbeteiligte und –beobachter verstrickte; schließlich habe er auf diese Weise aber auch die Einheit seiner Persönlichkeit selbst zerstört. Für diese These, die Frau Stangneth umfangreich begründete, können nur einige wenige Belege gegeben werden: Seine Lügen beruhigten nicht nur die (von Arendt sehr kritisch gesehenen) Judenräte. Den ungarischen Juden Rudolf Kasztner, der über 1600 Landsleute rettete, aber nicht verhindern konnte, dass Hunderttausende von ihnen nach Auschwitz, in den Tod, deportiert wurden, nannte er seinen „Beschwichtigungshofrat“. Aber Manipulationsversuche, zum Teil in der Form von Kompetenzüberschreitungen Eichmanns, sind schon aus frühester Zeit gegenüber seinen Nazi-Kollegen nachweisbar. Er konnte aus jedem Detail Profit im Hinblick auf die Erreichung seiner Ziele schlagen. Eichmann war in der Realität das Gegenteil eines Bürokraten gewesen. Er führte seine Erfolge in der Judenvernichtung gerade darauf zurück, dass er an bestimmten Punkten die Bürokratie ausgeschaltet habe. In Jerusalem hingegen täuschte er Vernehmer, seinen behandelnden Arzt, aber vor allem die Prozessbeobachter dadurch, dass er sich zum bürokratischen Schreibtischtäter stilisierte.
An diesem Punkt stellt sich die Frage, welchen Wert Arendts These von der „Banalität des Bösen“ hat, die auf der Überzeugung beruht, dass, wer denkt und wer sich in andere hineinversetzen kann, nicht Böses tut.
Eichmann als „Hanswurst“ zu sehen, der nicht denken könne, hat sich nämlich im Nachhinein als Irrtum erwiesen. Frau Stangneth berichtete, dass Eichmann in der NS-Zeit ein großes Lesepensum bewältigt habe, um den Feind – die Juden – zu erforschen. Dem steht nicht entgegen, dass er auch auf diesem Gebiet große hochstaplerische Fähigkeiten an den Tag legen konnte. Eichmann habe die antisemitische Ideologie des Nazi-Reichs nicht einfach rezipiert – nein, er habe aktiv an ihr gearbeitet.
Arendts These, Eichmann habe sich nicht in andere Menschen hineinversetzen können, trifft genauso wenig zu wie die, er sei unfähig gewesen zu denken: „Leider nein!“, sagte Frau Stangneth; außerhalb des Prozesses habe er diese Fähigkeit sogar in außergewöhnlichem Maße besessen, die schließlich die Grundlage seiner gelungenen Manipulation war.
Hannah Arendt war nicht die einzige, die sich in Eichmann täuschte; in Jerusalem waren die meisten BeobachterInnen verwirrt von der Diskrepanz zwischen dem Eichmann, den sie zu sehen erwartet hatten, und dem, der vor Gericht agierte.
Bettina Stangneth schätzt Arendts Buch trotz der genannten Irrtümer. Diese erklärten sich außer durch Eichmanns „bodenlose Verlogenheit“ auch dadurch, dass viele Quellen seinerzeit nicht zugänglich waren. Die so genannten „Sassen-Interviews“ waren nur teilweise bekannt; Eichmann bestritt aber vor Gericht erfolgreich ihre Authentizität. Außerdem wurden die so genannten „Argentinien-Papiere“ erst durch Frau Stangneths Forschungen zu Tage gefördert. Um zu begründen, worin Arendts Verdienst bestehe, sagte sie: „Eichmanns gab es viele.“ Hannah Arendt habe in Eichmann nur das falsche Beispiel erwischt. Auf der anderen Seite könne nicht von dem „Eichmann in uns allen“ geredet werden, wie es vielfach geschehen sei. Arendt habe dagegen ihren Ausdruck von der „Banalität des Bösen“ gesetzt, die darin besteht, dass ein Mensch sich keine Gewissensbisse hinsichtlich der Folgen seines Handelns macht.
In der anschließenden Diskussion wurde unter anderem gefragt, welchen Sinn Eichmanns Lügengespinst gehabt habe, das er in Jerusalem ausgebreitet habe. Die überraschende Antwort lautete: Eichmann habe auch dort seinen „Krieg gegen die Juden“ nicht aufgegeben, und er habe seinen Hals retten wollen. Er habe nicht damit gerechnet, gehängt zu werden.
II
Im Folgenden möchte ich noch auf zwei weitere Vorträge aus dem Begleitprogramm zur Ausstellung eingehen, die ich besucht habe.
Bei dem ersten handelt es sich um ein Kuriosum: Willi Winkler, ein Redakteur der „Süddeutschen Zeitung“, hatte den Titel „Geheimoperation Jerusalem. Der Eichmann-Prozess als Kristallisationspunkt vielfältiger Interessen“ angekündigt. Leider sehe ich mich außerstande, über den Vortrag zu berichten, den er am 12.2. gehalten hat. Der Grund ist banal, aber schlüssig: Herr Winkler war schlichtweg nicht zu verstehen. Von Anbeginn wurde er – und dieser Vorgang wiederholte sich etliche Male – gebeten, langsam und deutlich zu sprechen; es gelang ihm nicht, sich verständlich zu machen. Mit dem Hall im Vortragsraum hatten alle Personen zu kämpfen, die dort sprachen, doch alle anderen waren gut zu verstehen. Die Moderatorin entschuldigte sich für die technische
Unzulänglichkeit,
doch – ihre Höflichkeit in allen Ehren – an der Technik lag es nicht. Da sich schon der erste Diskussionsredner mit der Klage meldete, nur einen Bruchteil des Vortrags verstanden zu haben, wurde angeboten, eine
Textfassung (die natürlich vom Inhalt des frei gehaltenen Vortrags abweicht) per E-Mail zuzusenden. Jedoch ist sie mir bisher noch nicht zugegangen, und selbst in diesem Fall wäre sie für mich keine akzeptable Grundlage für einen Veranstaltungsbericht. Es sei nur soviel angedeutet: Winkler hat zu der Frage recherchiert, wer – außer dem Staat Israel – die Verteidigung Eichmanns in Jerusalem finanziert hat. Er ist zu dem Ergebnis gekommen, dass ein rechtsradikales Netzwerk aus dem Erlös von Schriften, die Eichmann in Jerusalem verfasste (insgesamt waren das ca. 8 000 Seiten) den von der israelischen Regierung bereitgestellten Betrag aufstockte und den Gang des Verfahrens zu beeinflussen versuchte.
Bereits am 5.2. hatte der Historiker Frank Bajohr, Mitarbeiter der „Forschungsstelle für Zeitgeschichte Hamburg“, zum Thema „Der Eichmann-Prozess und die Öffentlichkeit. Reaktionen und Konsequenzen in Hamburg und der Bundesrepublik“ referiert (übrigens im selben Saal, in dem später Willi Winkler sprach).
Anhand von Meinungsumfragen wies Bajohr nach, dass für Regierung und Öffentlichkeit die Befürchtung im Vordergrund stand, durch den Eichmann-Prozess könnte das Ansehen der BRD Schaden nehmen. Liberale Blätter wie SPIEGEL, STERN und ZEIT äußerten sich sehr kritisch über die Legitimität des Prozesses – im Gegensatz zu Springer-Zeitungen, noch vor der Einführung der „Grundsätze“ (die 1967 in Kraft traten).
Die Aussagen von Überlebenden im Jerusalemer Gericht führten in der Haltung der Öffentlichkeit einen Umschwung herbei: Nun war die „Schlussstrich“-Mentalität nicht mehr durchsetzbar; die Erkenntnis „Eichmanns gab es viele“ setzte sich durch; die Vorstellung, die faschistischen Täter seien „Halbverrückte“ gewesen, ließ sich angesichts des Auftreten Eichmanns vor Gericht (als Biedermann) nicht mehr halten; die Einsicht in die Arbeitsteiligkeit bei der Judenvernichtung tritt an die Stelle der Vorstellung sadistischer Einzeltäter.
Folgen auf der politisch-juristischen Ebene waren in Hamburg: Nachdem Senator Biermann-Ratjen (FDP) aus Begründungen von Todesurteilen, die in der NS-Zeit ausgesprochen worden waren, vorgelesen hatte, treten 13 von 16 schwerbelasteten Richtern und Staatsanwälten zurück.
Zwar hielt sich bis in die 90er Jahre die Legende von der „sauberen Wehrmacht“, doch (so schloss Bajohr seinen Vortrag): „Ein wichtiger Anfang war gemacht – nicht mehr, aber auch nicht weniger.“
Wir sind weiterhin gefordert.