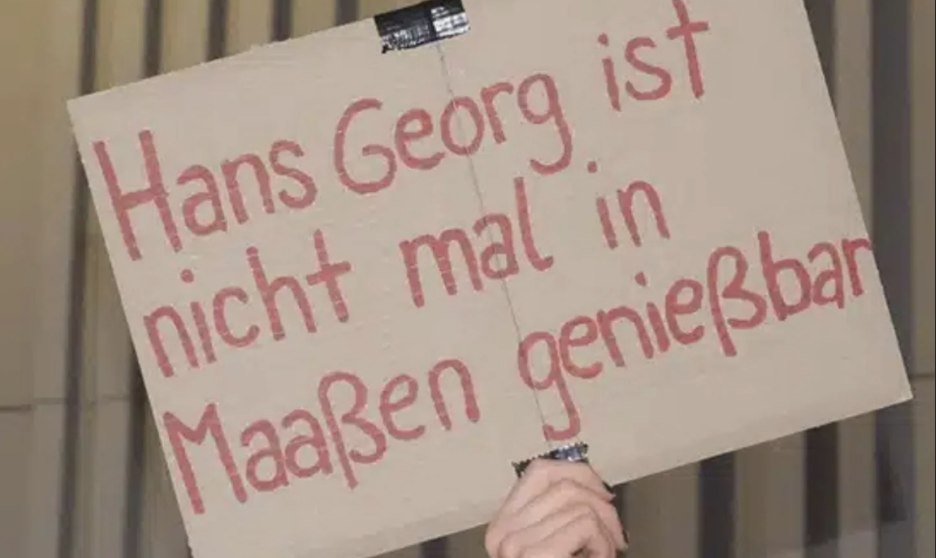von erk
Hamburgs Beratungsnetzwerk gegen Rechtsextremismus: Ein Strohfeuer
Kurz vor der Bürgerschaftswahl verkündete die Hamburger Sozialbehörde medienwirksam die Gründung eines „Beratungsnetzwerk gegen Rechtsextremismus“ mit angegliederten mobilen Interventionsteams.
Ausschlaggebend war für den alten CDU-Senat jedoch nicht das Erstarken des organisierten Neofaschismus in Hamburg oder die drastische Zunahme von Straftaten der extremen Rechten – 2006 war Hamburg das West-Bundesland mit den meisten rechten Straftaten pro Einwohner – als vielmehr die banale Tatsache, dass es ab Januar 2008 Bundesmittel gab. So konnte der Senat im Februar Engagement vortäuschen, welches es bis heute, auch mit grünem Koalitionspartner, nicht gibt.
Für das BNW kommen jährlich 125.000 Euro aus dem Bundesprogramm „kompetent. für Demokratie – Beratungsnetzwerke gegen Rechtsextremismus“, aus Landesmitteln kommen nur schäbige 20.000. Doch auch mit diesem Etat ist bisher nicht viel geschehen, sieht man von der Züchtung eines bürokratischen Wasserkopfes ab. Bis Mitte September haben sage und schreibe 3 Sitzungen des BNW (Vorstellung des Bundesprogramms, Lagebericht Rechtsextremismus und Lernstrategien demokratischer Rechtsextremismusprävention) stattgefunden, Beratungstätigkeit im eigentlichen Sinne fand noch gar nicht statt.
Leider ist die Inaktivität beim BNW dazu mit Inkompetenz gekoppelt. Die Landeskoordinationsstelle und die Geschäftsführung des BNW sind in Hamburg bei der „Johann Daniel Lawaetz-Stiftung“ angesiedelt. Diese hat zwar Erfahrungen mit Netzwerken, Quartierentwicklung, Gewaltprävention und Zivilcourage, „Erfahrungen mit Projekten im Bereich des Rechtsextremismus gehörten jedoch nicht zu den Anforderungen“ erklärte der schwarz-grüne Senat auf Anfrage.
Ein ausgearbeitetes Konzept für die Arbeit des BNW scheint nach einem halben Jahr noch nicht vorzuliegen, stattdessen versucht man die Inaktivität durch beschönigende Phraseologie zu verschleiern. Der Geschäftsführung „obliegt prozessbegleitende Sicherung der Qualität der Netzwerkarbeit …als Landeskoordinierungsstelle unterstützt sie auch die zuständige Behörde bei der Wahrung ministerieller Aufgaben im Zuge des Bundesprogramms“, heißt es in der Aufgabenbeschreibung. Hier deutet sich ein bürokratischer Wasserkopf an, der die beteiligten staatlichen und nicht staatlichen Akteure, Arbeitskreise und Netzwerke koordiniert, verwaltet und der Öffentlichkeit präsentiert und damit wahrscheinlich auch schon seine personellen und finanziellen Ressourcen erschöpft hat.
Inhaltliche Richtlinie beim BNW ist die altbekannte und unwissenschaftliche Totalitarismus-Doktrin, nach der rot gleich braun sei. Bei der Vorstellung im Februar machte die damalige Sozialsenatorin Birgit Schnieber-Jastram diesen Umstand gleich in den ersten beiden Sätzen deutlich: „Unser demokratisches Staatswesen wird von Extremisten aller Couleur bedroht. Besonders junge Menschen sind dabei oft Ziel extremistischer Aktivitäten.“ Und ergänzte nach einigen Ausführungen zum BNW: „Darüber hinaus dürfen wir aber nicht auf dem linken Auge blind werden.“
Es ist also zu Erwarten, dass „Rechtsextremismus“ im Sinne des BNW im wesentlichen als Jugend- und Gewalt-Phänomen begriffen wird, gesellschaftliche und strukturelle Ursachen kaum im Fokus sind und Intervention vor allem als „Feuerwehrpolitik“ betrieben wird statt mit langfristigen Konzepten zu agieren.
Auch die personelle Zusammensetzung lässt darauf schließen, dass die Bekämpfung von Neofaschismus weniger Aufgabe der Zivilgesellschaft, als vielmehr staatlicher Ordnungspolitik sein soll.
Linke und antifaschistische Organisationen, sieht man von DGB und dem Landesjugendring ab, sind im BNW nicht vertreten. Von den 37 regelmäßig zum BNW eingeladenen Personen kommen 17 aus den 4 angeschlossenen Behörden und weitere 6 aus anderen staatlichen Institutionen, darunter der Verfassungsschutz, das LKA 71 und weitere Angehörige der Polizei. Federführend ist die Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz unter Senator Dietrich Wersich. Auf externen Sachverstand aus Kirchen, anderen Religionsgemeinschaften und Sportverbänden bspw. ist verzichtet worden.
Doch damit wird nicht nur auf Kompetenz von Institutionen an der Basis verzichtet, sondern auch das nötige Vertrauen für krisenbezogene Beratung und Intervention aufs Spiel gesetzt. Repressionsorgane wie die Polizei oder ein Geheimdienst verfolgen oftmals eigene Ziele und rufen bei möglichen Hilfesuchenden, z.b. aussteigewilligen Nazis oder besorgten Angehörigen, berechtigte Skepsis hervor.
Zweites Kernstück des Senatsprogramms soll der Aufbau von Mobilen Beratungsteams (MBT) sein. Diese können angefordert werden, wenn „rechtsextremistische Gruppen versuchen, Institutionen zu unterwandern oder vor Schulen für ihr Gedankengut zu werben,“ erklärte Schnieber-Jastram Anfang des Jahres. In anderen Bundesländern, z. B. Mecklenburg-Vorpommern oder Sachsen-Anhalt, laufen diese Projekte schon seit längerem ganz erfolgreich, wenn auch mit unzureichenden Mitteln ausgestattet und am staatlichen Gängelband gehalten. In Hamburg versäumte der schwarz-grüne Senat selbst hier lange die erfolgreiche Umsetzung. Schon im Mai wurde die Geschäftsführung der MBTs ausgeschrieben, beworben hatte sich ausschließlich die DGB-Jugend, welche auch im BNW vertreten ist. Diese war der Sozialbehörde aber scheinbar wenig genehm, eine Besetzung des Trägers der MBT erfolgte erst jetzt durch „Arbeit und Leben“ sowie durch die DGB-Jugend. Diese haben jetzt eine Stelle zur „Koordination der Mobilen Beratungsteams“ ausgeschrieben, die Arbeitsaufnahme kann also frühestens Ende November erfolgen. Die Stelle ist vorläufig befristet für ein Jahr und Ende 2010 laufen dann das gesamte Bundesprogramm und die Förderung schon wieder aus. Die 145.000 Euro für dieses Jahr hätte damit der schwarz-grüne Senat erfogreich beim Kampf gegen rechts in den Sand gesetzt. Und dass in der Aufgabenbeschreibung der MBTs die „Überprüfung der Nachhaltigkeit der Intervention“ gegenüber neofaschistischen Krisen gefordert wird, ist angesichts dieses Strohfeuers wohl eher ein Witz.
Quellen: Bürgerschaftsdrucksache 19/1038 und div. Presseartikel