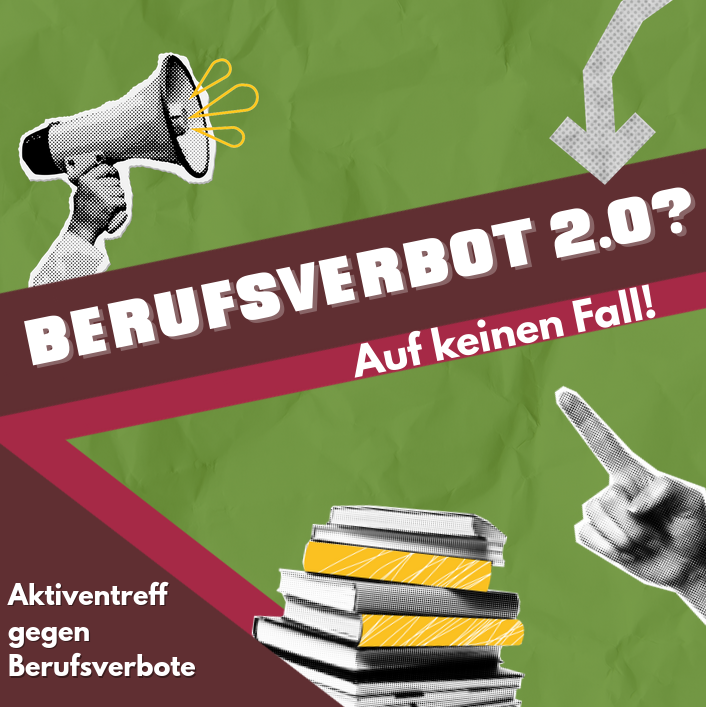Christoph Butterwegge, Blätter für deutsche und internationale Politik
Die neue Bundesregierung begreift den Rechtsextremismus offenbar als bloßes Randgruppenphänomen. Ihre Gleichsetzung desselben mit Linksradikalismus und Islamismus bedeutet zugleich einen Paradigma- und Strategiewechsel. Denn laut Koalitionsvertrag sollen die bestehenden Bundesprogramme gegen den Rechtsextremismus1 mit einem Jahresbudget von zusammen 24 Mio. Euro „unter Berücksichtigung der Bekämpfung linksextremistischer und islamistischer Bestrebungen“ in allgemeine Projekte gegen Extremismus umgewandelt werden. Dadurch werden die Gefahren des Rechtsextremismus für die Demokratie relativiert – und bei stabilem Mittelaufkommen weniger Aktivitäten dagegen finanziert.
Zurück in die 50er Jahre?
Ins Bild passt dabei, dass der Koalitionsvertrag die „Aufarbeitung des NS-Terrors und der SED-Diktatur“ im selben Atemzug nennt. Diese tendenzielle Gleichsetzung erinnert an die Totalitarismustheorie aus der Zeit des Kalten Krieges. Während der 50er und frühen 60er Jahre wurden in der Bundesrepublik alle geistig-politischen Kräfte im Kampf gegen den Kommunismus mobilisiert. Was lag da näher, als diesen unter dem Oberbegriff „Totalitarismus“ mit dem Nationalsozialismus mehr oder weniger explizit gleichzusetzen? Zudem gab es für das deutsche Bürgertum keine geeignetere Konzeption, um die eigene kampflose Preisgabe der Weimarer Republik als das Resultat einer „doppelten Frontstellung“ gegenüber Rechts- und Linksextremisten zu entschuldigen, die geistigen Berührungspunkte mit dem Nationalsozialismus zu verschleiern und die selbstkritische Aufarbeitung der NS-Zeit überflüssig zu machen. Außerdem bot die Totalitarismustheorie eine Möglichkeit, die Mitschuld einflussreicher Gesellschaftskreise an der „Machtergreifung“ des Hitlerfaschismus, genauer: der Machtübergabe an die Nazis, zu relativieren. Die Weimarer Republik sei, so hieß es, am Zusammenspiel der Verfassungsfeinde links- und rechtsaußen zugrunde gegangen.