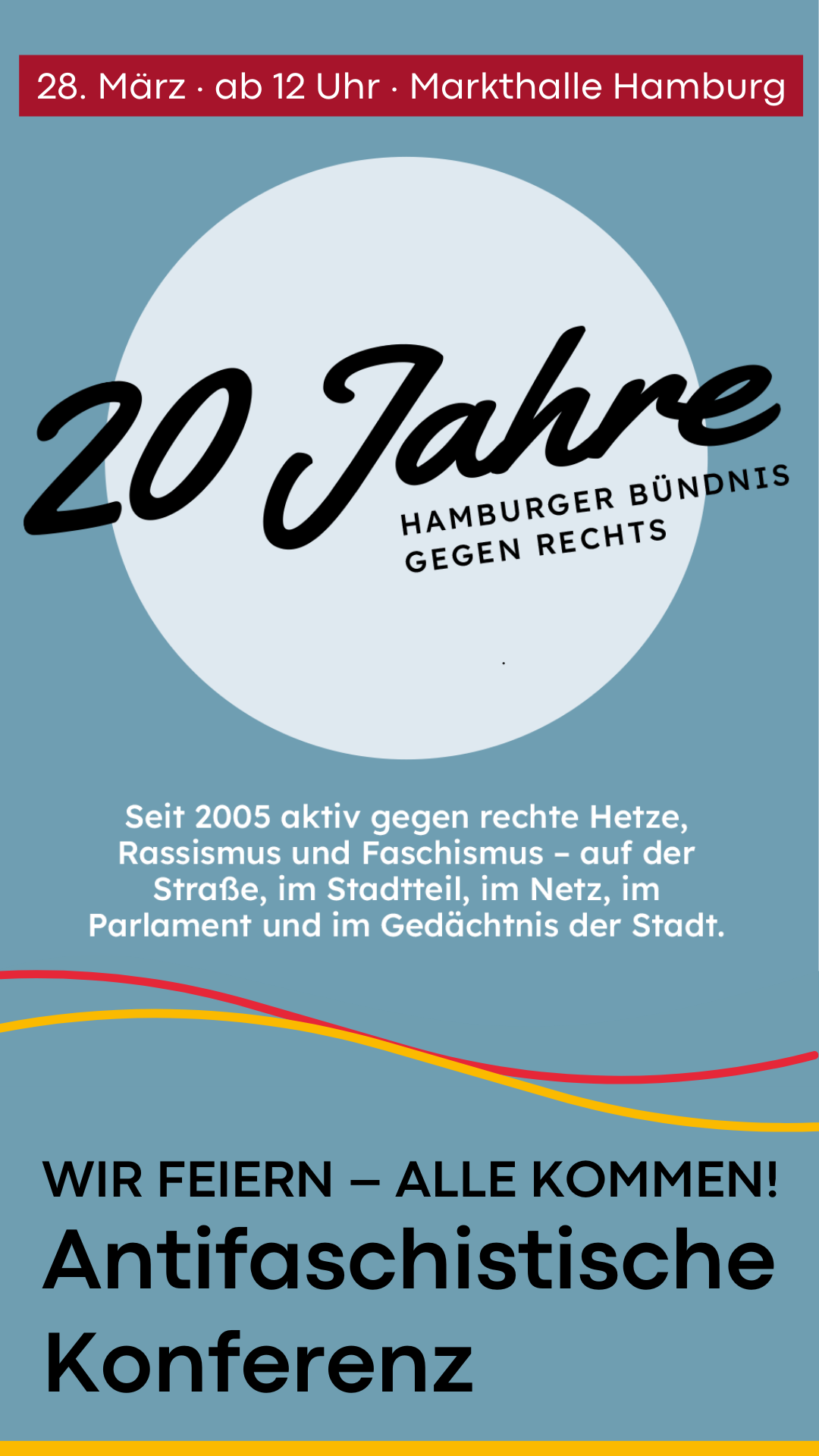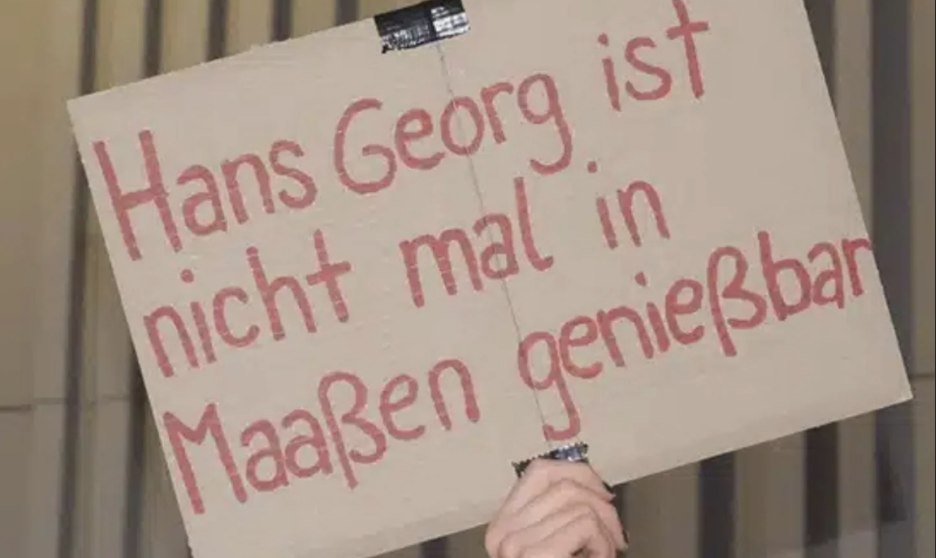Junge Welt, von Lothar Zieske (30.11.11)
Hamburg: Parteien sprechen sich für Ehrung von »Fahnenflüchtigen« während des Faschismus aus
In Hamburg fordert das »Bündnis für ein Deserteursdenkmal« seit Sommer 2010 »ein dauerhaftes Gedenken und eine dauerhafte Stätte der Erinnerung an die Opfer der NS-Militärjustiz.« Ein Ort ist auch schon ausgesucht: »Kein Platz ist für ein Deserteursdenkmal geeigneter als am Kriegerdenkmal am Stephansplatz«, so das Bündnis. Der 1936 errichtete sogenannte Kriegsklotz erinnert in verherrlichender Weise an die toten Soldaten des Ersten Weltkriegs. Er trägt die Inschrift »Deutschland muß leben, auch wenn wir sterben müssen.« Mehrfach wurde der Klotz vom Bündnis verhüllt. Auch mit Lesungen und Theateraufführungen trugen die Kriegsgegner ihr Anliegen, die Ehrung der Deserteure der Wehrmacht, in die Öffentlichkeit.weiterlesen
Ungekürzter Artikel von Lothar Zieske hier
Von Lothar Zieske
In Hamburg mahnt ein „Bündnis für ein Deserteursdenkmal“ seit Sommer 2010 „ein dauerhaftes Gedenken und eine dauerhafte Stätte der Erinnerung an die Opfer der NS-Militärjustiz an.“ Zum Ort für diese „dauerhafte Stätte“ äußert sich das „Bündnis“ eindeutig: „Kein Platz ist für ein Deserteursdenkmal geeigneter als am 76er Kriegerdenkmal am Stephansplatz.“ (http://www.niqel.de/deserteur/index.htm ; auf dieser Seite werden auch die Bündnispartner im einzelnen genannt.)
Der 1936 errichtete Kriegsklotz erinnert bekanntlich in kriegsverherrlichender Weise an die toten Soldaten des Ersten Weltkriegs und trägt die provozierende Inschrift: „Deutschland muss leben, auch wenn wir sterben müssen.“
Durch die Aktivitäten dieses Bündnisses (vor allem verschiedene Verhüllungsaktionen – zweimal wurde die Folie abgerissen – , verbunden mit Lesungen, Theateraufführungen, Musik und Ansprachen) ist das Thema „Deserteure der Wehrmacht“ in Hamburg wieder an die Öffentlichkeit gebracht worden. Sie sind als Hintergrund zu sehen für die von der Evangelischen Akademie der Nordelbischen Kirche und von der KZ-Gedenkstätte Neuengamme durchgeführte Veranstaltungswoche „Aufklärung und Protest – Erinnern an die Opfer und Täter des Krieges“ (12. bis 19.11).
Umso befremdlicher, dass auf dem Podium der Veranstaltung „Kriegerdenkmal und Gegendenkmal am Stephansplatz – ein Ort für das in Hamburg fehlende Deserteursdenkmal?“ (14.11.) die Initiative nicht vertreten, ihr Gestaltungsvorschlag für die Umgestaltung des Kriegsklotzes jedoch als Illustration für das Faltblatt mit dem Veranstaltungsprogramm (mit dem Herkunftshinweis: „privat“) verwendet worden war. Auf diesen Faux-pas hingewiesen, entschuldigte sich der hierfür Verantwortliche bei René Senenko vom „Bündnis“.
Die geschilderten Missklänge sind deswegen umso bedauerlicher, weil die Podiumsdiskussion ein erfreuliches, dazu auch noch unerwartetes Ergebnis gebracht hatte: Die in der Bürgerschaft vertretenen Parteien, die in der Reihenfolge des Alphabets zu Wort gekommen waren (Andreas Wankum von der CDU, Thomas-Söhnke Kluth von der FDP, Anja Hajduk von der GAL, Norbert Hackbusch von der Linken, Christel Oldenburg von der SPD) hatten sich dafür ausgesprochen, dass in Hamburg ein Denkmal für die Deserteure der Wehrmacht errichtet werden sollte, dass dieses die Funktion eines Gegendenkmals zum Kriegsklotz haben sollte und dass dabei auch Veränderungen am Kriegsklotz vorgenommen werden dürften bzw. sollten. Hierbei kam es zu bemerkenswerten Äußerungen. Von diesen sollen nur drei genannt werden:
– Christel Oldenburg, die sich als Schlussrednerin der ersten Podiumsrunde erstaunt über die Einigkeit auf dem Podium zeigte, übte indirekt Selbstkritik an ihrer Partei und berichtete, dass die SPD erst in den 90er Jahren ein positives Verhältnis zu den Wehrmachtsdeserteuren aufgebaut habe.
– Unangenehm reflexhaft äußerte daraufhin Anja Hajduk, sie wolle aber nun die Differenzen diskutieren. Opposition ist offentlich etwas, das nach längerer Regierungsbeteilgung erst wieder gelernt werden muss.
– Kluth kennzeichnete zunächst seinen Beitrag als mit der Partei nicht abgesprochen und zitierte dann zur Begründung seiner dann vorgetragenen Privatmeinung Bertolt Brecht: „Wo Recht zu Unrecht wird, wird Widerstand zur Pflicht.“ Außerdem äußerte er, am liebsten würde er die kriegsverherrlichende Inschrift entfernen lassen, distanzierte sich dann aber gleich wieder von dieser Absicht, die er als „hilflos“ bezeichnete.
Allein Reinhard Soltau (FDP) – ehemals für kurze Zeit Bildungssenator, der als Landesvorsitzender des Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge redete, wandte sich gegen den Standort am Stephansplatz und sprach sich stattdessen für ein Denkmal am Strafgerichtsgebäude sowie – auf Nachfrage – dagegen aus, am Kriegsklotz Veränderungen vorzunehmen. Es stellte sich nachträglich heraus, dass der Volksbund eingeladen worden war, um es möglichst allen Parteien erleichtern, sich für ein Deserteursdenkmal auszusprechen. Der Gedanke muss folgender gewesen sein: Wenn sich schon der Volksbund an der Debatte beteiligt, könnt ihr es euren Mitgliedern vermitteln, dass ihr euch positiv äußert. Dass der Volksbund eine abweichende Meinung vertreten würde, war sicher absehbar, widersprach aber der geschilderten Absicht offenbar nicht. Außerdem wurde dadurch, dass der Landesvorsitzende eine nicht völlig ablehnende, sondern eine eingeschränkt zustimmende Meinung vertreten würde, die Möglichkeit eröffnet, dass gegenüber den dort vertretenen sehr viel kritischeren Positionen ein Zeichen gesetzt würde.
Die Kehrseite dieses „Spiels über die Bande“ war dann, dass das „Bündnis für ein Deserteursdenkmal“ politisch nicht mehr auf das Podium passte. Nur Eingeweihte konnten wissen, dass es über die „Mantelorganisation“ („Stiftung Hamburger Geschichtswerkstätten“) überhaupt zu den Mitveranstaltern gehörte. Die teilnehmenden Mitglieder saßen jedoch die gesamte Zeit über im Publikum.
Dass es nun auch im politischen Rahmen vorangehen dürfte, machte Norbert Hackbusch deutlich, der zugleich Vorsitzender des Kulturausschusses ist; er kündigte an, er werde auf dessen nächster Sitzung eine Expertenanhörung zum Thema vorschlagen.
Lothar
Zieske