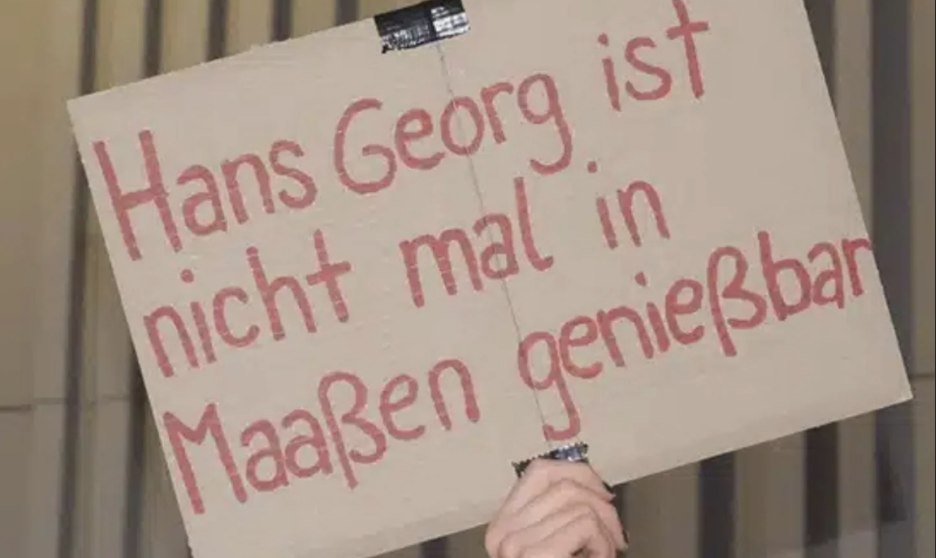von Lothar Zieske
Wenn es zutrifft, was einer der Festredner sagte – dass nämlich nördlich einer Linie bei Kassel alle Lehrerinnen und Lehrer Esther Bejarano durch ihre Zeitzeugengespräche in Schulen, ihre Lesungen und ihre Konzerte, nicht zuletzt zusammen mit der „Microphone Mafia“, kennen (und daran ist nicht zu zweifeln) – dann wissen sicher noch viel mehr Menschen, was der Titel „Mir leben ejbig“ für ihr Leben bedeutet. Esther Bejaranos vor 10 Jahren erschienene, in Zusammenarbeit mit Birgit Gärtner verfasste Biographie trägt diesen Titel in Übersetzung: „Wir leben trotzdem“. Dieser Satz fasst viele Facetten ihres Lebens zusammen, und diese vielen Facetten bestimmten auch den „feierlichen Empfang“, zu dem der Bezirksamtsleiter und die Vorsitzende der Bezirksversammlung Nord der Stadt Hamburg am 15. Dezember anlässlich ihres 90. Geburtstags eingeladen hatten.
Um gleich eine naheliegende Vermutung abzuweisen: Auch Reden von Personen aus der Hamburger Verwaltung müssen nicht steif und trocken wirken. Als ein besonders eindrückliches Gegenbeispiel sei nur die Ansprache Manfred Schönbohms genannt, der, wie er selbst sagte, u. a. das Amt für „Wiedergutmachung“ leitet; er ließ deutlich werden, dass es für die Verbrechen des Faschismus keine „Wiedergutmachung“ geben kann.
Reden spielten an diesem Tag natürlich eine große Rolle, aber zunächst einmal zur Musik, die während der Feier gespielt wurde, denn die Musik hat bekanntlich entscheidend dazu beigetragen, dass Esther Bejarano Auschwitz überleben konnte – als Mitglied des Mädchenorchesters; dass damit wiederum ungeheure Qualen verbunden waren – spielen zu müssen vor Menschen, von denen sie wusste, dass sie ermordet würden – machte ihr Überleben bitter.
Schon im ersten Teil des Musikprogramms wurde dieser Zusammenhang deutlich: Das Klavierduo Friederike Haufe/ Volker Ahmels begann mit Stücken von zwei Komponisten, die dem Faschismus zum Opfer fielen: der Niederländer Dick Kattenburg in Auschwitz und der in Prag geborene Erwin Schulhoff auf der Wülzburg bei Weißenburg/Bayern. Er wollte 1941 in die Sowjetunion übersiedeln, wurde aber nach dem Überfall auf die Sowjetunion als feindlicher Ausländer nach Deutschland zurückgeschickt. Das bedeutete sein Todesurteil; er war, wie Kattenburg, Jude.
Bei einer großen Geburtsfeier für Esther durfte natürlich der Hamburger Gewerkschaftschor nicht fehlen; er sang u. a. „Comandante Che Guevara“. Und spätestens damit hatte sich die Befürchtung erledigt, in eine SPD-Veranstaltung geraten zu sein. Wer noch zweifeln mochte, wurde durch den Dank eines Besseren belehrt, den die VVN-Vorsitzende Conny Kerth Esther für ihre Unterstützung in der Krise der VVN nach 1989 abstattete: Esther habe darauf bestanden, dass natürlich auch Kommunisten der VVN angehören dürften.
Nach diesen wenigen Andeutungen sollte schon klar geworden sein, dass es sich um eine bunte Veranstaltung handelte. Am besten lässt sich die Atmosphäre durch den Vergleich mit der einer großen Familienfeier veranschaulichen: Die einzelnen Mitglieder stehen sich zwar unterschiedlich nahe, und die, die sich eher fremd fühlen, gehen vielleicht etwas eher. Die sich aber – ob berechtigt oder nicht – der Jubilarin nahe fühlten, blieben auch, bis die letzte Rede gehalten wurde (Rolf Becker redete sehr persönlich, engagiert wie immer, und er würdigte die Einladung Esther Bejaranos beim Papst als großes politisches Ereignis), und sie erlebten anschließend eine temperamentvolle Musikgruppe (Stefan Goreiski-Trio, Efim Kofmann), die Esther so sehr mitriss, dass sie rief: „Warum tanzt hier denn keiner?“ Das ließen sich einige Gäste nicht zwei Mal sagen, Esther Bejarano eröffnete den Tanz und wirkte trotz ihrer 90 Jahre und trotz des inzwischen fortgeschrittenen Abends überhaupt nicht müde.
Es gibt den jüdischen Geburtstagswunsch „Mögest du 120 Jahre alt werden“; natürlich wurde er an diesem Tage auch ausgesprochen. Wer Esther Bejarano erlebte, mochte ihn vielleicht gar nicht mehr für unrealistisch halten.