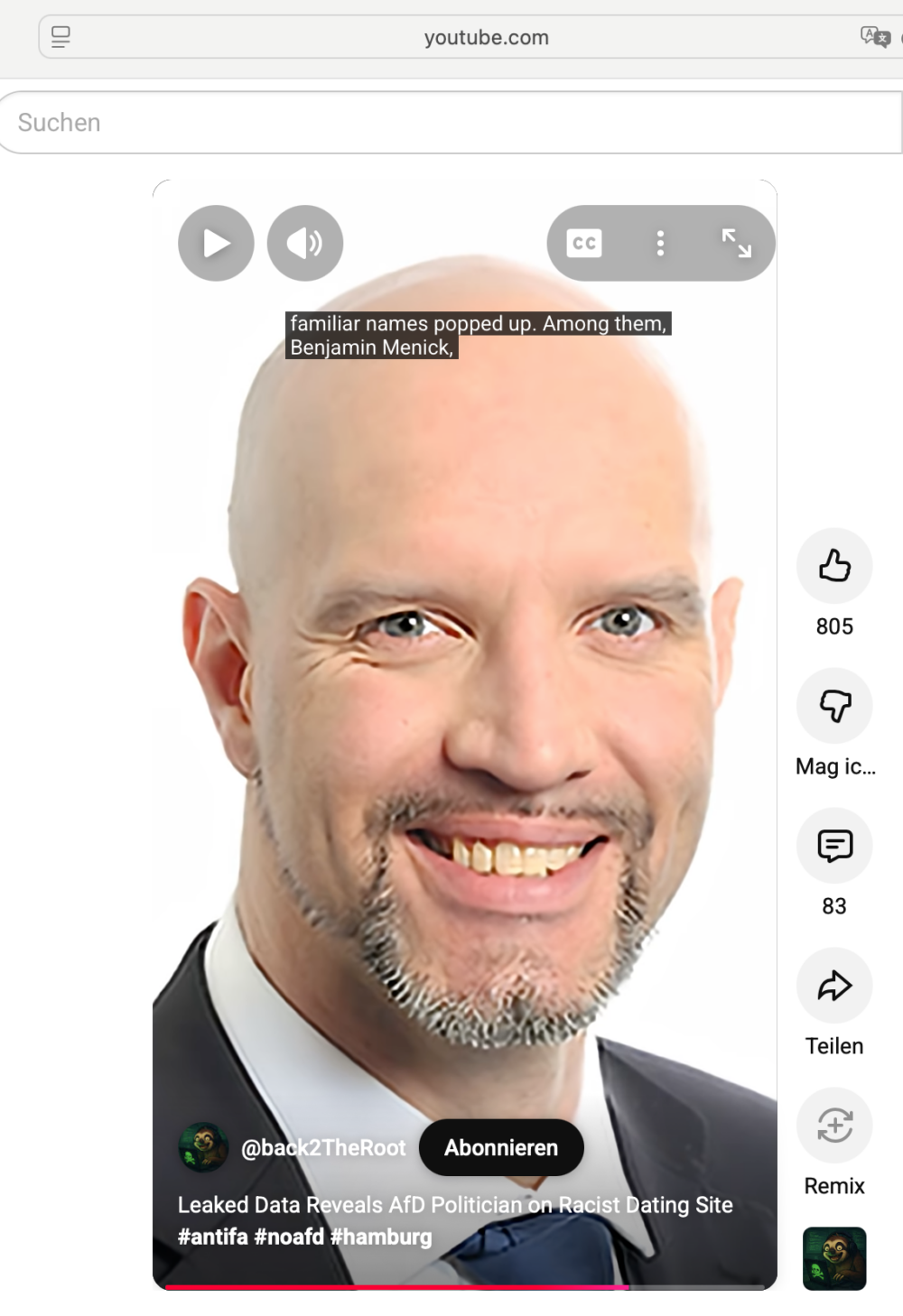von Lothar Zieske
Das mag der eine oder die andere jetzt denken. Doch dauert auf der einen Seite der Zustand immer noch an, dass die Familienministerin Schröder versucht, zivilgesellschaftliche Initiativen durch die Gleichsetzung von angeblich „extremistischer“ linker und rechter Politik und durch die Verpflichtung zur Bespitzelung von kooperierenden Organisationen, die sie ihnen auferlegt, in ihrer Arbeit zu behindern und zu schwächen. Auf der anderen Seite ist der Widerstand gegen diese Versuche bisher eher gering. Daher ist jede Veranstaltung zu begrüßen, die auf das Problem aus neuer Perspektive aufmerksam macht.
Auf dem Podium – in diesem Fall „am Tresen“ – im Centro sociale saßen am 19.08. neben der Moderatorin Vertreter von apabiz Berlin, von „Arbeit und Leben“ und vom Bündnis „Rechtsextremismusstudien stoppen“ aus Hamburg sowie eine Rechtsanwältin aus Jena.Im Gegensatz zu der Veranstaltung der Rosa-Luxemburg-Stiftung (vgl. LB 16/11 [18.8.]: „Geld gegen Gesinnung“) wurde die theoretische Auseinandersetzung bewusst kurz gehalten. Für die theoretische Vertiefung wurde eine neu erschienene Broschüre von avanti* verwiesen, die anschließend verkauft wurde.
Es ging an diesem Abend also schwerpunktmäßig um die Praxis eines politischen Ansatzes aus der konservativen Ecke, der als Theorie nicht bezeichnet werden sollte. Denn dieser Ansatz verfolgt nicht das Ziel, sich mit linken Initiativen intellektuell auseinander zu setzen, sondern will ihnen das Leben schwer machen. Von dieser Praxis sind die Personen, die am Tresen saßen, in unterschiedlicher Weise betroffen.
Die Anwältin aus Jena berichtete zwar nicht aus der Perspektive einer direkt Betroffenen; dafür war aber der „Praxis“-Bezug am konkretesten: Es ging nämlich um die Anwendung der Extremismusdoktrin** durch die sächsische Polizei und Justiz gegen Personen, die sich im vergangenen Februar den Neonazis in Dresden in den Weg gesetzt hatten. Die meisten Fakten dürften aus der Tagespresse bekannt sein; daher nur einige Stichworte: Speicherung von 1 Million Handydaten, Übergriff der Polizei gegen ein Haus, in dem DIE LINKE, verschiedene Initiativen, aber auch Anwälte ihre Büros haben, Durchsuchung der Wohnung eines Pastors in Jena von Sachsen aus ohne vorherige Absprache mit den entsprechenden thüringischen Stellen.
Es ergab sich das Bild eines Bundeslandes, in dem die Gewaltenteilung aufgehoben worden ist – natürlich nicht, weil dort inzwischen eine Rätedemokratie errichtet worden wäre; vielmehr wurde der SPIEGEL mit dem Ausdruck zitiert, wonach Sachsen das „unfreieste Bundesland der Republik“ sei (SPIEGEL 31/11). Hier sorgt zusätzlich ein Netz entsprechender Wissenschaftler (vor allem Uwe Backes und das „Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung“ der TU Dresden sowie der Politologe Eckhard Jesse von der TU Chemnitz) für eine Ausformung dieser Doktrin, die es ermöglicht, dass Neonazis geschont und Linke verfolgt werden.
Was es bedeutet, unter die erpresserische Forderung gesetzt zu werden, zwischen der Unterwerfung unter die „Extremismusklausel“ und dem Verzicht auf antifaschistische Projekte wählen zu müssen, wurde aus dem Bericht des Vertreters von „Arbeit und Leben“ deutlich; es ist keine leichte Entscheidung, wenn beispielsweise die Opferberatung auf dem Spiel steht. Dabei zeigte es sich, dass der Fall des AkuBiZ aus Pirna, das die Unterschrift verweigerte, wohl weiterhin eher als Ausnahme anzusehen sein wird.
Das apabiz aus Berlin hingegen genießt bisher noch eine privilegierte Stellung, da der dortige Senat sich bisher bereit erklärt, in die Bresche zu springen, wenn es darum geht, dass bestimmten Initiativen Gelder verweigert werden, weil sie sich weigern, die Unterschrift unter die Selbstverpflichtung gemäß der Extremismusklausel zu setzen.
Doch trotzdem hat sich die Situation auch einer solchen Initiative insofern verschlechtert, als der Verfassungsschutz inzwischen den Anspruch erhebt, in den Schulen als angeblicher Experte für Bildungsarbeit gegen Rechts aufzutreten. Entschließt sich eine Initiative, als Gegenpart in einer schulischen Veranstaltung aufzutreten, verleiht sie der Arbeit des Geheimdienstes ungewollt das Siegel der Ausgewogenheit. Abgesehen davon kann es nicht ohne Folgen bleiben, wenn der Verfassungsschutz mit ungleich mehr Geld für Personal und Sachmittel zusammen mit einer Initiative auftritt, die meist mit Freizeitkräften und beschränkten Mitteln dagegenzuhalten versucht. Die Situation ist sattsam bekannt aus dem Auftreten von Jugendoffizieren der Bundeswehr an Schulen.
Der Vertreter des Bündnisses „Extremismusstudien stoppen“, der an der Fachhochschule am Rauhen Haus studiert, berichtete über den letztlich misslungenen Versuch, den Abbruch einer Studie zu bewirken, die „Aufschluss über Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren geben [sollte], die sich selber als ‚linksautonom’ begreifen. Es soll[te] hierbei unter anderem geklärt werden, ob diese ‚Szene’ an ‚gewalttätigen Auseinandersetzungen in Szenestadtteilen und Sachbeschädigungen in Hamburg’ [ …] beteiligt war und ob dies politisch motiviert war. Des Weiteren soll[te] erforscht werden, ob und wie die Sozialarbeit dort eingreifen kann/muss.“ (http://extremismusstudienstoppen.blogsport.de/2011/03/05/presseerklaerung-des-buendnisses-gegen-extremismusstudien-am-rauhen-haus/) Der Student beklagte sich vor allem darüber, dass die Gegenseite alles getan habe, um das Anliegen des Bündnisses „lächerlich zu machen“. In diesem Zusammenhang sprach er von der „Sisyphusarbeit“, die es erfordere, der Öffentlichkeit klar zu machen, was die Aktivitäten auf der Grundlage der „Extremismusdoktrin“ politisch bedeuten.
Dieser Sicht ist nur zuzustimmen; ich sehe in den Aktivitäten im Rahmen der „Extremismusdoktrin“ einen Schritt zurück in die 70er bzw. in die 50er Jahre: – in die 70er Jahre, weil die damals beginnende Berufsverbotspraxis die Verpflichtung auf die „freiheitlich- demokratische Grundordnung“ als Basis hatte,
-
ein Begriff, der seinerseits für die Bedürfnisse des Prozesses vor dem Bundesverfassungsgericht entwickelt worden war, der mit dem Verbot der KPD endete.
-
Nach dem Verbot der KPD galt für Kooperation mit illegalisierten Mitgliedern dieser Partei die Drohung, strafrechtlich mit dem Vorwurf der „Kontaktschuld“ konfrontiert zu werden.
-
Die Drohungen, die von der sächsischen Justiz gegen TeilnehmerInnen an Blockaden gerichtet werden, orientieren sich an einem Gewaltbegriff,
wie
er in der Weimarer Zeit noch nicht gültig war; damals verstand die Justiz unter Gewalt, soweit sie juristisch zu sanktionieren war, den Einsatz von körperlicher Kraft. Dass zur Zeit des Faschismus Gewalt auch im psychologischen Sinn definiert wurde (z. B.: sich in den Weg setzen, um die Staatsgewalt an ihrem Tun zu hindern, weil man/frau damit rechnet, diese werde den Widerstand gegen Sitzende nicht mit Pferden oder motorisierten Fahrzeugen brechen), verfolgte das Ziel, die politischen Gegner juristisch als Verbrecher hinstellen zu können.
Das Thema „Extremismusklausel“
ist also – um den Titel der Avanti-Broschüre zu zitieren – „extrem wichtig“.
Lothar Zieske
* Avanti – Projekt undogmatische Linke (Hrsg.): Extrem wichtig: Linke Politik. Beiträge zur Kritik der Extremismusdoktrin und der Inlandsgeheimdienste, 2011, 42 S., 1 EUR Schutzgebühr
** Durch den Ausdruck „Doktrin“ soll deutlich gemacht werden, dass es sich nicht um eine vollwertige Theorie, sondern um ein gedankliches Konstrukt handelt, das für politische Zwecke eingesetzt wird.